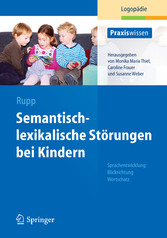
Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern - Sprachentwicklung: Blickrichtung Wortschatz

von: Stephanie Rupp
Springer-Verlag, 2013
ISBN: 9783642380198
Sprache: Deutsch
292 Seiten, Download: 6257 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Mehr zum Inhalt

Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern - Sprachentwicklung: Blickrichtung Wortschatz
| Geleitwort | 6 | ||
| Vorwort | 8 | ||
| Die Autorin | 10 | ||
| Die Herausgeberinnen | 11 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 13 | ||
| Kontaktdaten der Herausgeberinnen | 17 | ||
| Kapitel-1 | 18 | ||
| Theoretische Grundlagen | 18 | ||
| 1.1 Von der Wahrnehmung zum Wort | 19 | ||
| 1.1.1 Wahrnehmung | 19 | ||
| 1.1.2 Aufbau mentaler Repräsentationen – Abbilder im »Kopf« | 22 | ||
| 1.1.3 Wörter als Stellvertreter – das Bezeichnete und das Bezeichnende | 25 | ||
| 1.1.4 Von der Wahrnehmung zum Wort – semiotisches Dreieck | 26 | ||
| 1.2 Was ist (Wort-)Bedeutung? | 28 | ||
| 1.2.1 Semantische Relationen in der Linguistik | 29 | ||
| 1.2.2 Semantiktheorien: Wie wird Bedeutung erfasst? | 31 | ||
| 1.2.3 Speicherung semantischer Inhalte – Netzwerkgedanke | 35 | ||
| 1.3 Morphologie | 36 | ||
| 1.3.1 Wortarten | 36 | ||
| 1.3.2 Wortbildung | 36 | ||
| 1.3.3 Speicherung von Wortformen im mentalen Lexikon | 37 | ||
| 1.4 Phonologische Gliederung von Wortformen | 38 | ||
| 1.4.1 Konstituentenmodell | 38 | ||
| 1.4.2 Phonologische Bewusstheit | 38 | ||
| 1.5 Das Lexikon im Kopf – Lexikonmodelle | 40 | ||
| 1.5.1 Mentales Lexikon | 41 | ||
| 1.5.2 Lexikonmodelle und kognitive Linguistik | 43 | ||
| 1.5.3 Arten der Modellierung | 44 | ||
| 1.6 Modell nach Dell | 50 | ||
| Literatur | 52 | ||
| Kapitel-2 | 54 | ||
| Physiologische Wortschatzentwicklung | 54 | ||
| 2.1 Die Sprachentwicklung im Allgemeinen | 55 | ||
| 2.1.1 Wie lernt ein Kind sprechen? – Faszination Spracherwerb | 55 | ||
| 2.1.2 Die (linguistischen) Ebenen der Sprachentwicklung | 58 | ||
| 2.1.3 Zeitlicher Ablauf des physiologischen Spracherwerbs | 60 | ||
| 2.2 Die Wortschatzentwicklung im Speziellen | 64 | ||
| 2.2.1 Vorsprachliche Entwicklung | 64 | ||
| 2.2.2 Frühes, kleines Lexikon | 68 | ||
| 2.2.3 Das Lexikon im Vokabelspurt – der Wortschatz explodiert | 70 | ||
| 2.2.4 Beobachtbare Phänomene beim Wortschatzerwerb | 77 | ||
| 2.2.5 Weitere Wortschatzentwicklung | 78 | ||
| 2.3 Die »an das Kind gerichtete Sprache (KGS)« | 83 | ||
| 2.3.1 Ammensprache (Baby-Talk) | 85 | ||
| 2.3.2 Stützende Sprache (scaffolding) | 85 | ||
| 2.3.3 Lehrende Sprache (motherese) | 85 | ||
| Literatur | 86 | ||
| Kapitel-3 | 90 | ||
| Semantisch-lexikalische Entwicklungsstörungen | 90 | ||
| 3.1 Sprachentwicklungsstörung | 91 | ||
| 3.1.1 Sprachliche Ebenen und Modalitäten | 91 | ||
| 3.1.2 Merkmale und Verlauf der spezifischen Sprachentwicklungsstörung | 95 | ||
| 3.1.3 Häufiges Initialsymptom einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung: Late-Talker-Profil | 96 | ||
| 3.2 Semantisch-lexikalische Entwicklungsstörung | 97 | ||
| 3.2.1 Symptome | 99 | ||
| 3.2.2 Ursachen | 100 | ||
| 3.2.3 Mögliche Auswirkungen und Folgen und ICF-Sichtweise | 104 | ||
| 3.2.4 Wortschatzauffälligkeiten außerhalb einer SSES | 106 | ||
| 3.2.5 Bezug der Sprachverstehensstörung zur semantisch-lexikalischen Entwicklungsstörung | 108 | ||
| 3.3 Einteilung semantisch-lexikalischer Entwicklungsstörungen und Suche nach dem Störungsschwerpunkt | 110 | ||
| 3.3.1 Funktionelle Ursacheneinteilung bei Wortfindungsstörungen nach Glück | 110 | ||
| 3.3.2 Subgruppeneinteilung nach Kauschke und Siegmüller | 113 | ||
| 3.3.3 Modellgeleitetes Vorgehen | 114 | ||
| Literatur | 120 | ||
| Kapitel-4 | 124 | ||
| Anamnese | 124 | ||
| 4.1 Ziele des Anamnesegesprächs | 125 | ||
| 4.1.1 Ziel: Informationsbeschaffung und Datenerhebung | 125 | ||
| 4.1.2 Ziel: Erfassung der persönlichen Gesamtsituation des sprachauffälligen Kindes | 126 | ||
| 4.1.3 Ziel: Beziehungsaufbau | 126 | ||
| 4.2 Wie kann das Anamnesegespräch geführt und gestaltet werden? | 127 | ||
| 4.2.1 Anamnesegespräch im Beisein des Kindes? | 127 | ||
| 4.2.2 Freies Gespräch oder Fragebogen? | 128 | ||
| 4.2.3 Gelungene Gesprächsführung | 129 | ||
| 4.3 Wer wird befragt, was wird erfragt? | 132 | ||
| 4.3.1 Formen der Anamnese | 132 | ||
| 4.3.2 Zeitliche Struktur und Themenbereiche des Anamnesegesprächs | 133 | ||
| 4.3.3 Fragen der Eltern | 136 | ||
| 4.4 Hinweise auf semantisch-lexikalische Probleme im Anamnesegespräch | 137 | ||
| Literatur | 139 | ||
| Kapitel-5 | 141 | ||
| Diagnostik | 141 | ||
| 5.1 Diagnostik: Klärung der Therapiebedürftigkeit (Indikation) und Basis der Therapieplanung | 142 | ||
| 5.1.1 Ziele der Erstdiagnostik | 142 | ||
| 5.1.2 Diagnostischer Prozess | 144 | ||
| 5.1.3 Weg durch den Dschungel – Ableitung diagnostischer Fragestellungen | 146 | ||
| 5.1.4 Ein weiteres Ziel der Diagnostik – Verlaufskontrolle | 148 | ||
| 5.2 Wie gut ist das Messinstrument? – Exkurs zur Testgüte | 149 | ||
| 5.3 Diagnostikmethoden im Bereich Semantik–Lexikon – und was lässt sich ableiten? | 152 | ||
| 5.3.1 Untersuchung des rezeptiven Wortschatzes | 152 | ||
| 5.3.2 Untersuchung des aktiven/produktiven Wortschatzes | 153 | ||
| 5.3.3 Spontansprachanalyse | 157 | ||
| 5.3.4 Nonverbale Aufgabenstellungen | 158 | ||
| 5.3.5 Sprachliche und nichtsprachliche Verhaltensbeobachtung | 158 | ||
| 5.4 Diagnostikverfahren | 159 | ||
| 5.4.1 Hat das Kind ein Risiko für eine Sprachentwicklungsstörung? – Late-Talker-Diagnostik | 159 | ||
| 5.4.2 Abklärung einer Sprachentwicklungsstörung | 162 | ||
| 5.4.3 Spezielle Untersuchungsverfahren im semantisch-lexikalischen Bereich | 169 | ||
| 5.4.4 Differenzialdiagnostische Fragestellungen | 175 | ||
| 5.5 Hilfestellung – Diagnostik am Modell | 178 | ||
| Literatur | 182 | ||
| Kapitel-6 | 184 | ||
| Ausgewählte Therapie- ansätze und Eltern- trainings | 184 | ||
| 6.1 Etablierte methodische Gestaltungsmöglichkeiten bei der semantisch-lexikalischen Therapie | 185 | ||
| 6.1.1 Methode der Inputtherapie (indirektes Vorgehen) | 186 | ||
| 6.1.2 Methode der Modellierung (indirektes Vorgehen) | 187 | ||
| 6.1.3 Methode der Kontrastierung | 187 | ||
| 6.1.4 Methode: Übung (direktes Vorgehen) | 189 | ||
| 6.1.5 Methode: Einsatz von Metasprache und Strategietraining | 189 | ||
| 6.2 Sprachsystematische (sprachspezifische) Therapiekonzepte | 190 | ||
| 6.2.1 Beschreibung und Einordnung unterschiedlicher sprachspezifischer Therapieformen nach Glück | 190 | ||
| 6.2.2 Patholinguistische Therapie nach Siegmüller und Kauschke - multimethodisches Vorgehen | 193 | ||
| 6.2.3 Entwicklungsproximaler Ansatz nach Dannenbauer - inszenierter Spracherwerb | 195 | ||
| 6.2.4 Word-finding-intervention-Programm (WFIP) nach German | 195 | ||
| 6.2.5 Wortschatzsammler nach Motsch - Strategietherapie bei Vorschulkindern | 196 | ||
| 6.2.6 Prosodie als Schlüssel zum Sprach- und Worterwerb | 197 | ||
| 6.2.7 Therapieansätze zur Verbesserung der phonologischen Bewusstheit | 198 | ||
| 6.3 Ganzheitliche Therapieansätze | 199 | ||
| 6.3.1 Ansatz nach Zollinger | 199 | ||
| 6.3.2 HOT - Handlungsorientierte Therapie | 201 | ||
| 6.4 Elterntrainings | 203 | ||
| 6.4.1 Heidelberger Elterntraining | 203 | ||
| 6.4.2 Frühe Sprachintervention mit Eltern - Schritte in den Dialog nach Möller | 204 | ||
| Literatur | 205 | ||
| Kapitel-7 | 208 | ||
| Einleitende Überlegungen zum therapeutischen Vorgehen | 208 | ||
| 7.1 Allgemeine Therapieprinzipien | 210 | ||
| 7.1.1 Motivation ist (fast) alles | 210 | ||
| 7.1.2 Kontakt | 211 | ||
| 7.1.3 Transparenz | 212 | ||
| 7.1.4 Sprechfreude und Kommunikation | 212 | ||
| 7.1.5 Blick für das Ganze | 214 | ||
| 7.1.6 Weg | 214 | ||
| 7.1.7 Entwicklungsorientiertes Vorgehen | 214 | ||
| 7.1.8 »Störungen« haben Vorrang! | 215 | ||
| 7.2 Überlegungen zur spezifischen Therapieplanung im semantisch-lexikalischen Bereich | 215 | ||
| 7.2.1 Beginn der Wortschatztherapie – Bestimmung des Therapieschwerpunkts | 216 | ||
| 7.2.2 Auswahl des linguistischen Materials – Zielitems | 216 | ||
| 7.2.3 Therapeutisches Vorgehen | 217 | ||
| 7.3 Modellgeleitetes Vorgehen | 219 | ||
| 7.4 Umgang mit Mehrsprachigkeit bei der Therapie semantisch-lexikalischer Störungen | 222 | ||
| 7.4.1 Was ist Mehrsprachigkeit? Wer ist mehrsprachig? | 222 | ||
| 7.4.2 Sprachentwicklungsstörungen und Mehrsprachigkeit | 224 | ||
| 7.4.3 Anamnese und Diagnostik | 224 | ||
| 7.4.4 Therapie | 227 | ||
| 7.4.5 Elternberatung und interkulturelle Kompetenz | 227 | ||
| 7.5 Clinical Reasoning | 230 | ||
| 7.5.1 Problemlösendes Denken | 230 | ||
| 7.5.2 Strategien zur Entscheidungsfindung | 231 | ||
| 7.5.3 Entscheidungsfindung und -begründung mithilfe von sieben kognitiven (Denk-)Prozessen | 231 | ||
| 7.5.4 Bewertung | 233 | ||
| Literatur | 234 | ||
| Kapitel-8 | 235 | ||
| Therapiebausteine | 235 | ||
| 8.1 Aufbau der ersten 50 Wörter | 238 | ||
| 8.1.1 Auswahl der ersten 50 Wörter | 238 | ||
| 8.1.2 Fallbeispiele zu Therapiezielen und Umsetzungsideen | 238 | ||
| 8.2 Weltwissen, Begriffsbildung und Aufbau multimodaler Konzepte | 242 | ||
| 8.2.1 Basisarbeit: multimodale Erfahrungen und Konzeptaufbau | 242 | ||
| 8.2.2 Nonverbales Kategorisieren/Klassifizieren – Begriffsbildung | 244 | ||
| 8.3 Quantitativer Wortschatz – mapping | 247 | ||
| 8.3.1 »Heraushören« der Wortform | 248 | ||
| 8.3.2 Referenzen herstellen | 248 | ||
| 8.3.3 Constraints – Auslösen des Fast-mapping-Prozesses | 249 | ||
| 8.3.4 Rezeptiver Wortschatz | 250 | ||
| 8.3.5 Produktiver Wortschatz | 251 | ||
| 8.4 Qualitative Wortschatzarbeit | 253 | ||
| 8.4.1 Ausdifferenzierung der phonologischen Wortrepräsentation, Strukturierung und Vernetzung der phonologischen Lexikonorganisation | 253 | ||
| 8.4.2 Ausdifferenzierung der Wortbedeutungsrepräsentation, Strukturierung und Vernetzung der semantischen Lexikonstruktur | 256 | ||
| 8.4.3 Itembasierte Wortschatzarbeit und die Nutzung von Synergieeffekten | 258 | ||
| 8.4.4 Steigerung der Abruffrequenz | 259 | ||
| 8.5 Strategietraining und Nutzung von Metasprache und Metawissen | 260 | ||
| 8.5.1 Anwendung von Abrufstrategien/Self-Cueing | 260 | ||
| 8.5.2 Wortschatzerweiterung durch Strategien | 261 | ||
| 8.6 Elternarbeit | 262 | ||
| 8.6.1 Elternberatung | 263 | ||
| 8.6.2 Mögliche Struktur und Aufbau eines Elterngesprächs | 264 | ||
| 8.6.3 Unterschiedliche Elterngespräche im Therapieverlauf | 266 | ||
| 8.6.4 Förderung der Elternkompetenzen in der semantisch-lexikalischen Therapie | 269 | ||
| Literatur | 270 | ||
| Serviceteil | 271 | ||
| A1 Spracherwerb | 273 | ||
| A2 Subgruppen semantisch-lexikalischer Entwicklungsstörungen und Late-Talker | 278 | ||
| A3 Diagnostische Informationen bei Sprachentwicklungsstörungen | 279 | ||
| A4 Anamnese bei Mehrsprachigkeit | 280 | ||
| A5 Strukturhilfe für das Elterngespräch | 282 | ||
| Stichwortverzeichnis | 285 |






