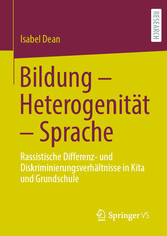
Bildung - Heterogenität - Sprache - Rassistische Differenz- und Diskriminierungsverhältnisse in Kita und Grundschule

von: Isabel Dean
Springer VS, 2020
ISBN: 9783658308568
Sprache: Deutsch
407 Seiten, Download: 3310 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
Mehr zum Inhalt

Bildung - Heterogenität - Sprache - Rassistische Differenz- und Diskriminierungsverhältnisse in Kita und Grundschule
| Danksagung | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einleitung | 11 | ||
| 1 Perspektivierungen des Übergangs zur Grundschule | 21 | ||
| 1.1 Eine „Schule für alle Kinder“? – Ungleichheitstheoretische Perspektiven | 21 | ||
| 1.2 Zwischen der Makro-Perspektive der institutionellen Diskriminierung… | 25 | ||
| 1.3 …und der Mikro-Perspektive der elterlichen Schulwahl | 32 | ||
| 1.4 Rassismustheoretische Perspektiven | 33 | ||
| 1.5 Die Perspektive der intersektionellen Formation | 42 | ||
| 1.6 Affekttheoretische Perspektiven | 46 | ||
| 1.7 Perspektive der Widerständigkeit und des Konflikts | 50 | ||
| 2 Den Übergang von Kita zu Grundschule erforschen | 54 | ||
| 2.1 Feldzugänge | 55 | ||
| 2.1.1 Feldforschung in der Berlin-Kreuzberger Primel-Kita | 55 | ||
| 2.1.2 Mental Maps und Kiezspaziergänge | 60 | ||
| 2.2 Ausweitung der Forschung | 63 | ||
| 2.2.1 Vom Feld zur Assemblage | 65 | ||
| 2.2.2 Der Übergang von Kita zu Grundschule als Aushandlungsraum | 68 | ||
| 2.3 Grenzen des Forschens in Beziehungen | 70 | ||
| 2.4 Zwischen Kollaboration und Kritik | 74 | ||
| 2.4.1 Paraethnografie | 76 | ||
| 2.5 Die Schattenseiten ethnografischer Feldforschung | 82 | ||
| 2.6 Das Ethnografieren von Differenz- und Ungleichheitsverhältnissen | 85 | ||
| 2.7 Bezeichnungspraxen und rassistisches Wissen | 90 | ||
| 2.8 Care-Verhältnisse – eine Forscherin unter Müttern, Erzieherinnen und Pädagoginnen | 93 | ||
| 3 (Neo-)Linguizismus im Schulkontext | 98 | ||
| 3.1 Neo-linguizistisches Sprachregime | 100 | ||
| 3.2 Widersprüchliche pädagogische Praktiken | 106 | ||
| 3.3 Linguale Dominanzverhältnisse durchbrechen | 118 | ||
| 3.4 ‚Chancen‘ und ‚Potenziale‘ von Mehrsprachigkeit | 121 | ||
| 3.5 Anerkennung sprachlicher Vielfalt | 125 | ||
| 4 Sprach- und Diversitätspolitiken in einer Berlin- Kreuzberger Kita | 128 | ||
| 4.1 Programmatik und Konzeption der Primel-Kita | 129 | ||
| 4.2 Steuerung der Gruppenzusammensetzung und elterliche Wahlpraxis | 133 | ||
| 4.2.1 Aufnahmesteuerung durch die Kita-Leiterin | 133 | ||
| 4.2.2 Pädagogische Begründungen für die Aufnahmesteuerung | 136 | ||
| 4.3 Herausfordernde Heterogenität – bereichernde Diversität? | 140 | ||
| 4.3.1 Deutsch-kompetente „Sprachvorbilder“ | 144 | ||
| 4.4 Institutionelle „Sprachförderung“ in der Primel-Kita | 157 | ||
| 4.4.1 Kommunikationssprache Deutsch | 157 | ||
| 4.4.2 Anknüpfung an der sprachlichen Situation eines Kindes | 159 | ||
| 4.4.3 Institutionelle Rahmenvorgaben der Sprachförderung | 161 | ||
| 4.4.4 Sprachbildung im Kita-Alltag | 167 | ||
| 5 Schulwahlpraktiken und -diskurse | 185 | ||
| 5.1 Heterogenes Wohnumfeld – heterogenes Schulumfeld? | 185 | ||
| 5.1.1 Bereicherungsdiskurse | 188 | ||
| 5.1.2 Othering- und Rassismuserfahrungen | 198 | ||
| 5.2 Schulwahl und ‚Bildungsnähe‘ | 205 | ||
| 5.2.1 Stellenwert von Schulwahl | 206 | ||
| 5.2.2 Ressourcen: Zeit, Geld, Wissen | 208 | ||
| 5.2.3 Bildungsferne vs. Bildungsinteresse als unscharfe Zuordnungen | 210 | ||
| 5.3 Schulleistung und Sprache | 212 | ||
| 5.3.1 „Kennst du nicht die Statistik?“ | 212 | ||
| 5.3.2 Klassenfragen | 215 | ||
| 5.3.3 Bildungssprache Deutsch | 218 | ||
| 5.3.4 Sozialräumliche Lage und Zusammensetzung von Schulen | 220 | ||
| 5.3.5 Abgrenzung nach ‚unten‘ | 226 | ||
| 5.4 Wertedebatten | 232 | ||
| 6 Gruppenanmeldungen und die Zusammensetzung von Schulklassen | 242 | ||
| 6.1 Wege der Initiierung von Gruppenanmeldungen | 245 | ||
| 6.2 Motivationen für die Praxis der Gruppenanmeldung | 249 | ||
| 6.2.1 „Wir […] sind Eltern, die den ersten Schritt gewagt haben“ | 252 | ||
| 6.3 Selbstschließungsprozesse | 254 | ||
| 6.3.1 Soziale Nähe der Gruppenanmeldungseltern untereinander | 254 | ||
| 6.3.2 Zugangsbarrieren zu den Gruppen | 258 | ||
| 6.4 Orientierung am „Gemeinwohl“ als Entwicklungshilfediskurs | 262 | ||
| 6.4.1 Unterstützung bei der Verbesserung des schulischen Images | 262 | ||
| 6.4.2 „Denn wir sind eigentlich die Eltern, die sie haben wollen.“ | 265 | ||
| 6.4.3 „Am Miteinander […] lernen“ | 268 | ||
| 6.4.4 Eine ‚Zivilisierungsmission in Problemvierteln‘ | 271 | ||
| 7 ‚Klasseneinteilungen nach Herkunft‘ als institutionelle Diskriminierungspraxis | 277 | ||
| 7.1 Zur „Durchmischung“ beitragen | 277 | ||
| 7.1.1 Machtpotenzial der Gruppenanmeldungseltern | 280 | ||
| 7.2 Nach ‚Herkunft getrennte Klassen‘ an Berliner Grundschulen | 283 | ||
| 7.2.1 „Deutsch-Garantie-Klassen“ | 285 | ||
| 7.2.2 Institutionelle Separation als Schärfung des Schulprofils | 289 | ||
| 7.3 „Leistungsspitzen“ und Schulvergleichsstudien | 291 | ||
| 7.4 ‚Klasseneinteilungen nach Herkunft‘ vermeiden | 295 | ||
| 8 Kämpfe um Anerkennung und Teilhabe | 302 | ||
| 8.1 Auseinandersetzungen um Eltern-Beteiligung an der Schule | 303 | ||
| 8.1.1 Elterliches Engagement an einer Berlin-Neuköllner Grundschule | 303 | ||
| 8.1.2 Gremienarbeit durch Elterninitiative | 309 | ||
| 8.1.3 Vermeintlich fehlende Selbstverständlichkeit von Engagement | 312 | ||
| 8.1.4 Rassismus- und Klassismusverhältnisse im Kontext von Schule | 319 | ||
| 8.2 Proteste gegen eine nach ‚Herkunft getrennte Klasse‘ | 323 | ||
| 8.2.1 Ausgangspunkte des Konflikts | 324 | ||
| 8.2.2 Affektive Intensitäten des Protests | 327 | ||
| 8.2.3 Anerkennungskämpfe als acts of citizenship | 333 | ||
| 8.2.4 Effekte der Thematisierung von Diskriminierung | 338 | ||
| 8.2.5 Wie Diskriminierungsroutinen durchbrechen? | 351 | ||
| Leerstellen und Ausblicke: Ein Fazit | 355 | ||
| Literatur | 361 |






