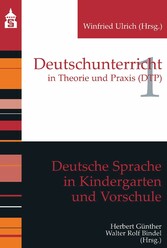
Deutsche Sprache in Kindergarten und Vorschule

von: Walter Rolf Bindel, Herbert Günther, Winfried Ulrich
wbv Media, 1949
ISBN: 9783763963591
Sprache: Deutsch
440 Seiten, Download: 7342 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
| Frontmatter | 1 | ||
| Cover | 1 | ||
| Impressum | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 6 | ||
| Vorwort des Herausgebers des Handbuchs | 8 | ||
| Vorwort der Herausgeber dieses Bandes | 12 | ||
| A Geschichte zur vorschulischen Sprachförderung | 14 | ||
| A1 Historische und aktuelle Aspekte zum Spracherwerb und der sprachlichen Bildung | 16 | ||
| 1 Zum Begriff der Sprachförderung | 16 | ||
| 2 Zur wissenschaftlichen Erforschung des kindlichen Spracherwerbs | 17 | ||
| 2.1 Erste Phase | 17 | ||
| 2.2 Zweite Phase | 18 | ||
| 2.3 Dritte Phase | 19 | ||
| 3 Konzeptionen sprachlicher Bildung aus der Praxis | 19 | ||
| 3.1 Sprache in der Kindergartenpädagogik | 19 | ||
| 3.2 Muttersprachliche Bildung in der Schule | 21 | ||
| 3.3 Kompensatorische Spracherziehung im Schulkindergarten | 21 | ||
| 3.4 Sprachheilpädagogische Entwicklungen | 23 | ||
| 4 Sprachliche Bildung heute | 25 | ||
| 4.1 Das familiäre Milieu | 26 | ||
| 4.2 Die Früherfassung und Identifikation | 26 | ||
| A2 Zur gegenwärtigen Struktur der sprachlichen Bildung | 28 | ||
| 1 Vorbemerkung | 28 | ||
| 2 Formen und Orte | 28 | ||
| 2.1 Prävention | 29 | ||
| 2.2 Vorschulische Bildungseinrichtungen | 29 | ||
| 3 Berufsgruppen | 32 | ||
| 4 Zur Qualität der sprachlichen Bildung | 35 | ||
| 5 Verordnungen und gesetzliche Regelungen | 36 | ||
| 6 Einrichtungen und Behörden | 39 | ||
| B Konzeptionelle und empirische Grundlage zum Spracherwerb | 44 | ||
| B1 Sprachentwicklung – Spracherwerb – Emergenz von Sprache | 46 | ||
| 1 Einführung | 46 | ||
| 2 Was ist Sprache? | 46 | ||
| 3 Wie entsteht die Sprache? | 49 | ||
| 3.1 Sprachentwicklung: deskriptiv betrachtet | 49 | ||
| 3.2 Pränatale Entwicklung und Spracherfahrung | 50 | ||
| 3.3 Präverbale Entwicklung | 51 | ||
| 3.4 Sprachliche Frühform (1–3 | 57 | ||
| 3.5 Die erweiterte Sprache (3 | 65 | ||
| 3.6 Entwicklungs-Gefährdungen | 69 | ||
| 4 Notwendigkeit und Möglichkeit von Sprachförderung | 70 | ||
| 5 Die Emergenz-Konzeption zum Spracherwerb – Grundlage für die Sprachförderung | 71 | ||
| 5.1 Hypothesen zum Spracherwerb | 71 | ||
| 5.2 Die Konzeption der Emergenz von Sprache | 73 | ||
| 6 Zur Diagnose | 74 | ||
| 7 Förder-Parameter | 76 | ||
| 7.1 Der Sprachdialog als Ko-Konstruktion | 77 | ||
| 7.2 Sprache bei Gruppen-Aktivitäten | 79 | ||
| 7.3 Literarisierung | 80 | ||
| 7.4 Die Rolle von Spiel und Fantasie | 83 | ||
| 7.5 Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund | 85 | ||
| 8 Schlussbemerkungen | 86 | ||
| B2 Spracherwerb und Gehirnforschung (unter Berücksichtigung des mehrsprachigen Spracherwerbs) | 94 | ||
| 1 Einleitung | 94 | ||
| 2 Früher Spracherwerb | 95 | ||
| 3 Spracherwerb und soziale Interaktion | 100 | ||
| 4 Mehrsprachiger Spracherwerb | 101 | ||
| 5 Zusammenfassung | 104 | ||
| B3 Grundlagen der Förderdiagnostik | 109 | ||
| 1 Bestimmungsstücke der Förderdiagnostik | 109 | ||
| 1.1 Förderdiagnostik ist keine Platzierungsdiagnostik | 109 | ||
| 1.2 Förderdiagnostik ist Situationsdiagnostik | 113 | ||
| 1.3 Förderdiagnostik ist Lernprozessdiagnostik | 115 | ||
| 1.4 Förderdiagnostik ist kompetenz- und defektorientiert | 116 | ||
| 1.5 Förderdiagnostik ist ein hypothesengeleiteter Prozess | 118 | ||
| 1.6 Förderdiagnostik braucht vorgeordnete Theorien | 120 | ||
| 2 Methoden der Sprachdiagnostik im Überblick | 123 | ||
| 2.1 Anamnese | 123 | ||
| 2.2 Verhaltensbeobachtung | 125 | ||
| 2.3 Informelle Verfahren | 128 | ||
| 2.4 Elternfragebögen | 131 | ||
| 2.5 Screening-Verfahren | 131 | ||
| 2.6 Psychometrische Verfahren | 134 | ||
| 2.7 Diagnostisches Gesamtkonzept | 136 | ||
| 3 Zusammenfassung | 139 | ||
| C Kompetenzbereiche als Förderbereiche | 144 | ||
| C1 Wie Kinder gut zur Sprache kommen – Förderung von kommunikativen Fähigkeiten und Sprache in den ersten Lebensjahren | 146 | ||
| 1 Voraussetzungen für gelingende Sprachförderung | 146 | ||
| 1.1 Was ist Sprachförderung? | 146 | ||
| 1.2 Sprachförderung und Sprachtherapie – wo liegen die Unterschiede? | 147 | ||
| 1.3 Beziehung und Bindung als Grundvoraussetzung nicht nur für sprachliches Lernen | 147 | ||
| 1.4 Sprachentwicklung und ihre Entwicklungsbedingungen | 149 | ||
| 2 Kommunikations- und Sprachförderung in der alltäglichen Interaktion | 150 | ||
| 3 Rahmenbedingungen für gelingende Sprachförderung | 157 | ||
| C2 Bausteine des Sprach- und Kommunikationsverhaltens in der Sprachförderung | 162 | ||
| 1 Einleitung | 162 | ||
| 2 Grundlegende Bausteine | 163 | ||
| 2.1 Wiederkehrende Kontexte mit sprachlichen Routinen | 163 | ||
| 2.2 Sprechanlässe nutzen | 165 | ||
| 2.3 Kommunikative Rahmenbedingungen | 168 | ||
| 3 Sprachliches Vorbild | 171 | ||
| 3.1 Allgemeine Merkmale | 171 | ||
| 3.2 Modellierungstechniken | 172 | ||
| 4 Ausblick | 176 | ||
| C3 Sprache und Sprachverstehen – eine sprachganzheitliche Konzeption | 178 | ||
| 1 Sprach-Screenings und Sprachverstehen | 178 | ||
| 2 Funktionale und dialogische Betrachtung des Spracherwerbs | 182 | ||
| 2.1 Sprache ist „das Verstehen des anderen herstellen“ | 182 | ||
| 2.2 Sprache bezieht sich auf die Intentionen anderer | 185 | ||
| 2.3 Die Vorbereitung auf die Sprache der Schule | 186 | ||
| 2.4 Das Erlernen einer zweiten Sprache | 188 | ||
| 2.5 Biologische Aspekte der Sprachentwicklung | 189 | ||
| 3 Sprachkompetenzen | 190 | ||
| 3.1 Personale Kompetenz | 190 | ||
| 3.2 Soziale Kompetenz | 191 | ||
| 3.3 Kognitive Kompetenz | 192 | ||
| 3.4 Kommunikative Kompetenz | 193 | ||
| 3.5 Sprachliche Kompetenz | 193 | ||
| 4 Aktivitäten zum Erwerb der Sprachkompetenz in der Institution Kindergarten | 194 | ||
| 4.1 Förderung der Kompetenzen | 195 | ||
| 4.2 Soziodramatisches Spielen: Eine Sprache für das Ich | 198 | ||
| 4.3 Dialogisches Bilderbuchlesen: Eine Sprache für die Schule | 202 | ||
| 5 Schlussbemerkungen | 206 | ||
| C4 Die Perspektive der Sozio-Pragmatik für Sprachentwicklung und Sprachförderung | 212 | ||
| 1 Einleitung | 212 | ||
| 2 Sprache und Sprachentwicklung aus sozio-pragmatischer Sicht | 212 | ||
| 2.1 Sprache als System versus Sprache in wirklicher Verwendung | 213 | ||
| 2.2 Aspekte der Sprachentwicklung | 214 | ||
| 2.3 Sprache für das Ich | 215 | ||
| 2.4 Sprache und biologische Entwicklung | 216 | ||
| 3 Dimensionen pragmatischer Kompetenz | 217 | ||
| 3.1 Die Sprache im Kontext-Bezug | 218 | ||
| 3.2 Die notwendigen Diskurs- und Konversationsfertigkeiten | 220 | ||
| 3.3 Die Beziehung zwischen Pragmatik und weiterer Sprachfähigkeit | 228 | ||
| 4 Konsequenzen für die vorschulische Sprachförderung | 229 | ||
| 4.1 Formen des Dialogs | 229 | ||
| 4.2 Die dynamische Lerngemeinschaft | 231 | ||
| 4.3 Textverstehen | 233 | ||
| 5 Diagnostische Aspekte | 235 | ||
| 5.1 Beobachtung der Interaktion | 235 | ||
| 5.2 Problematik der Testverfahren – diskursive Betrachtung und Testkritik | 239 | ||
| 5.3 Beispiel zur Überprüfung des textuellen Sprachverstehens | 241 | ||
| 6 Fazit | 245 | ||
| C5 Sprachförderung durch dialogisches Bilderbuchlesen | 251 | ||
| 1 Einleitung | 251 | ||
| 2 Wesensmerkmale und Formen | 251 | ||
| 2.1 Was sind Bilderbücher? | 251 | ||
| 2.2 Klassifikation | 252 | ||
| 2.3 Bedeutung und Funktion von Bilderbüchern | 255 | ||
| 2.4 Auswahlkriterien für Bilderbücher | 259 | ||
| 2.5 Dialogisches Bilderbuchlesen | 263 | ||
| 2.6 Fördermöglichkeiten | 266 | ||
| 3 Ausblick | 275 | ||
| C6 Hörerziehung als Voraussetzung für Sprache und Sprechen | 280 | ||
| 1 Einleitung | 280 | ||
| 2 Zur Bedeutung des Hörens in der Erziehung | 282 | ||
| 3 Vom Hören zum Zuhören | 285 | ||
| 3.1 Charakterisierung des Zuhörens | 285 | ||
| 3.2 Fallbeispiele zum Hören unter erschwerten Bedingungen | 287 | ||
| 4 Beobachtungsmöglichkeiten von Teilaspekten des Hörens bei Kindern | 293 | ||
| 5 Hörerziehung als pädagogische Intervention | 296 | ||
| 5.1 Methodische Grundsätze der Hörerziehung | 297 | ||
| 5.2 Zuhörfreundliche und kommunikationsfördernde Lernsituationen | 297 | ||
| 5.3 Optimierung als Sprecher- und Zuhörmodell | 299 | ||
| 6 Praktische Materialien zur Hörerziehung | 301 | ||
| D Sprachförderung unter Migrationsbedingungen | 310 | ||
| D1 Förderung des frühen Fremdsprachenlernens in Kindergarten und Vorschule | 312 | ||
| 1 Fremdsprachen im Elementarbereich | 312 | ||
| 2 Der Faktor „Input“ | 314 | ||
| 3 Ziele fremdsprachlicher Lern- und Spieleinheiten | 318 | ||
| 4 Aktuelle Konzepte | 320 | ||
| 5 Gestaltung fremdsprachlicher Einheiten | 322 | ||
| 6 Fremdsprachen im europäischen Verständnis | 325 | ||
| 7 Schlussbemerkungen | 330 | ||
| D2 Chancen der Mehrsprachigkeit und frühes Lernen einer zweiten Sprache | 333 | ||
| 1 Vorbemerkung | 333 | ||
| 2 Begriffsklärung | 334 | ||
| 3 Verbreitung der Mehrsprachigkeit | 335 | ||
| 4 Theoretische Grundlagen der Entwicklung zur Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit | 336 | ||
| 4.1 Die Universalgrammatik | 337 | ||
| 4.2 Der Interlanguage-Ansatz | 338 | ||
| 4.3 Neurowissenschaftliche Befunde zur Zweisprachigkeit | 339 | ||
| 4.4 Interdependenz- bzw. Schwellenhypothese und Semilingualismus | 340 | ||
| 5 Einige Besonderheiten des frühen Zweitspracherwerbs | 342 | ||
| 6 Rahmenbedingungen für den Erwerb einer zweiten Sprache | 344 | ||
| 7 Institutionalisierte Förderung der Zweisprachigkeit | 347 | ||
| 8 Chancen der Mehrsprachigkeit | 349 | ||
| D3 Frühsprachliche Bildung bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern | 355 | ||
| 1 Mehrsprachigkeit, die neue Herausforderung | 355 | ||
| 2 Aspekte der Mehrsprachigkeit | 357 | ||
| 2.1 Sprachmischung und Sprachwechsel | 357 | ||
| 2.2 Wortschatzentwicklung | 358 | ||
| 3 Mehrsprachigkeit und sozialer Kontext | 359 | ||
| 4 Zur sprachlichen Bildung | 362 | ||
| 5 Bildungspartnerschaft mit Eltern | 364 | ||
| 6 Schlussbemerkungen | 366 | ||
| D4 Ansätze zu einer Diagnostik von Sprachleistungen bei Kindern mit Migrationshintergrund | 368 | ||
| 1 Einführung | 368 | ||
| 2 Rahmenbedingungen vorschulischer Sprachstands-Erhebungen in 12 Bundesländern | 369 | ||
| 3 Einflussfaktoren der Sprachentwicklung mehrsprachig aufwachsender Kinder | 372 | ||
| 4 Zwischenstadien zur deutschen Sprache | 373 | ||
| 5 Beobachtungs- und Prozess-Diagnostik | 378 | ||
| 6 Praxis der sprachheilpädagogischen Einzel- und Gruppendiagnostik | 382 | ||
| 6.1 Das Problem der Test-Situation/Testkritik | 382 | ||
| 6.2 Spielerische Formen der Einzelfall-Diagnostik | 384 | ||
| 6.3 Spielerische Formen der Gruppen-Diagnostik | 388 | ||
| 7 Entwicklungsbeobachtungen | 388 | ||
| E Sprachförderung in heterogenen Gruppen | 400 | ||
| E1 Mehrsprachigkeit, sozio-kulturelle Vielfalt und Altersmischung als Merkmale von heterogen zusammengesetzten Gruppen | 402 | ||
| 1 Einleitung | 402 | ||
| 2 Keine Homogenität der Gruppe durch gleiches Alter der Kinder | 403 | ||
| 2.1 Erweiterte Altersmischung | 404 | ||
| 2.2 Theoretische Ansätze | 404 | ||
| 2.3 Die Forschung zur (erweiterten) Altersmischung | 405 | ||
| 2.4 Zunehmende Altersheterogenität in Grundschulklassen in Deutschland | 407 | ||
| 2.5 Verkürzung der Bildungszeit für das einzelne Kind in heterogenen Gruppen? | 408 | ||
| 3 Interkulturelle und inklusive Pädagogik in den Bildungseinrichtungen | 410 | ||
| 3.1 Ein inklusives Konzept | 413 | ||
| 3.2 Homogenisierung von Gruppen – eine ungeeignete Lösung? | 414 | ||
| 3.3 Eine entwicklungsangemessene Praxis | 415 | ||
| E2 Sprecherziehung für pädagogische Fachkräfte im Vorschulbereich – ein wünschenswertes Konzept | 422 | ||
| 1 Kommunikative Anforderungen an Erzieher/innen | 422 | ||
| 2 Zum Ausbildungsprofil | 423 | ||
| 2.1 Der notwendige Sprecheignungstest | 424 | ||
| 2.2 Teilmodul Grundlagen des Sprechens und Hörens | 426 | ||
| 2.3 Teilmodul Rhetorische Kommunikation | 429 | ||
| 2.4 Teilmodul Sprechkünstlerische Kommunikation | 430 | ||
| 3 Bildungsstandards für Eltern? | 432 | ||
| Backmatter | 436 | ||
| Sachwortregister | 438 | ||
| Backcover | 442 |







