
Entwicklung und Frühförderung von Kindern mit Down-Syndrom - Das Programm 'Kleine Schritte'
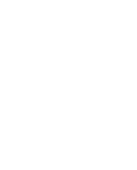
von: Meindert Haveman
Kohlhammer Verlag, 2013
ISBN: 9783170276529
Sprache: Deutsch
250 Seiten, Download: 7974 KB
Format: EPUB, PDF, auch als Online-Lesen
Mehr zum Inhalt

Entwicklung und Frühförderung von Kindern mit Down-Syndrom - Das Programm 'Kleine Schritte'
1 Bausteine einer effektiven Frühförderung
Meindert Haveman
1.1 Einleitung
Gerade die Begleitung von sehr jungen Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann eine komplexe und schwierige Aufgabe für deren Eltern sein. Da schon viele Aspekte der Erziehung, Bildung und Förderung durch außerfamiliale professionelle Organisationen wie Kindergarten und Schule wahrgenommen werden, sollte hier dann nicht auch die Frühförderung außerfamiliär stattfinden? Im Ausland gibt es dafür genügend Beispiele.
Auch hier und jetzt gibt es jedoch viele Argumente, um Frühförderung und Familie eng zu verknüpfen. In diesem Kapitel sollen einige aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen aufgezeigt werden, die zu einer erhöhten Relevanz einer Frühförderung in den Familien beitragen. Es geht dabei um sehr verschiedene Bereiche. Um nur einige zu nennen: die Entwicklungspsychologie, die Neurobiologie und -physiologie, die Familiensoziologie und die sozialdemographische Forschung. Mit den Entwicklungen im letzteren Bereich möchten wir beginnen.
1.2 Sozial-demographische Entwicklungen
Familie und Verwandtschaft stellen zweifellos die bedeutsamste Gruppenform der Menschheit dar. Ihr Ursprung ist älter als jede andere Gruppenform auf lokaler Basis, wie zum Beispiel Gemeinde und Gemeinschaft. Der Begriff „Familie“ bezeichnete ursprünglich die Gesamtheit derer, die einer Hausgemeinschaft durch Verwandtschaft und Abhängigkeit gesellschaftlich angehörten. Erst im Zuge der Industrialisierung beginnen sich die Familienbeziehungen und Funktionen zu verändern und schließlich langsam aufzulösen.
Vor einem viertel Jahrhundert hatte Cooper (1981) den „Tod der Familie“ prophezeit. Wenn er das Paradigma einer „traditionellen Normalfamilie“ meinte, dann hat er Recht behalten. Der Idealtypus einer bürgerlichen Familie war schon früher real betrachtet eher selten zu finden und ist in der reinen Form heute so gut wie ausgestorben. Sie „besteht aus einem Mann und einer Frau, die legal verbunden in einer dauerhaften und sexuell exklusiven Erstehe mit ihren Kindern in einem gemeinsamen Haushalt leben. Dabei widmet sich der Mann voll dem Berufsleben, während die Frau sich weitgehend aus der Berufstätigkeit zurückzieht, um volle Verantwortung für Haushalt und Kindererziehung zu übernehmen“ (Scanzoni et al., 1989). Für jedes einzelne Kennzeichen dieses traditionellen Familienleitbildes und der bürgerlichen Familie vergangener Jahre haben sich pluriforme Alternativen herausgebildet (Macklin, 1987; Haveman, 2000). Grenzübergreifend hat sich eine experimentierfreudige Beziehungskultur zwischen Menschen geformt, die sich in heterogenen Familienformen äußert. Es wurde und wird auch heute noch viel diskutiert über Probleme „der Familie“, wie die Distanzierung der Generationen, zunehmende Therapiebedürftigkeit der Familienmitglieder, innerfamiliäre Gewalt, Brüche in der familiären Erziehungspraxis und wachsende Scheidungsraten.
Vor allem die wachsenden Scheidungsraten in den nord-, mittel- und westeuropäischen Ländern sind beeindruckend. Die Möglichkeit, dass verheiratete Frauen oder Männer während ihres Lebens geschieden werden, ist in den letzten Jahrzehnten erheblich gestiegen. Die Studie von Miettinen (1997) zeigt den Verlauf ab 1970 für einige Länder der Europäischen Union. Lag die Wahrscheinlichkeit, dass eine deutsche Frau oder ein deutscher Mann während ihres Lebens geschieden werden, 1970 noch bei 16 Prozent, so hatte sich dieser Prozentsatz 1995 verdoppelt (32 Prozent). Auffallend konsistent sind die Nord-Süd-Unterschiede zwischen den Ländern, wenn wir uns die Ergebnisse für die 1990er Jahre anschauen. Nahezu die Hälfte aller nordeuropäischen Ehepartner, ein Drittel der west- und mitteleuropäischen, und ungefähr ein Zehntel der südeuropäischen Ehen sind mindestens einmal geschieden.
Wie steht es aber um die Ehen, in denen Kinder mit geistiger Behinderung geboren werden? Das länderübergreifende Klischee, Ehen zerbrächen an der Behinderung des Kindes, ist falsch (Van Berkum & Haveman, 1995). Wenn schon, dann sind es die sich aus der Behinderung ergebenden Belastungen, die einen Risikofaktor für die Ehe darstellen (Haveman et al., 1997; Müller-Zurek, 2002, 33). Bei einer repräsentativen Stichprobe unter Eltern mit Kindern mit geistiger Behinderung fanden Haveman et al. (1997) im südlichen Teil der Niederlande übrigens keine höhere Scheidungsrate für Eltern mit geistig behinderten Kindern. Von den Eltern mit geistig behinderten Kindern waren 86 Prozent verheiratet oder lebten mit einem Partner zusammen (für die niederländische Bevölkerung waren dies 84 Prozent; ebd., 327).
Durch die Ehescheidungen hat sich die Zahl der Ein-Eltern-Familien in den letzten Jahrzehnten in Deutschland erhöht. Sie haben auch bewirkt, dass, wenn auch nur in einem geringen Umfang, die Stiefelternfamilien zugenommen haben. Ihr Anteil an allen Familienformen beträgt heutzutage acht Prozent (Onnen-Isemann, 2002). Die Adoptions-Familien nehmen dagegen laufend ab. Hier übersteigt die Nachfrage das Angebot. Die Pluralität der Familienformen mag nach außen hin den Schein einer großen Heterogenität als Erziehungsinstanz wecken. Gerade in dieser Hinsicht hat sich jedoch nichts Wesentliches gewandelt. So gilt auch heute, dass noch über 80 Prozent der Kinder bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Umgekehrt bedeutet dies übrigens auch, dass ungefähr ein Fünftel aller Kinder ohne ihre leiblichen Eltern aufwächst und dass es einen deutlichen Trend zu Ein-Eltern-Familien gibt. Es kam und kommt zu vielen Geburten in nichtehelichen Partnerschaften. In Ostdeutschland wohnen knapp ein Drittel der Kinder unter zwei Jahren und elf Prozent der sechs- bis siebenjährigen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 1999).
Alle diese gesellschaftlichen Änderungen, die direkt oder indirekt die Institution „Familie“ betreffen, gelten auch für Familien mit geistig behinderten Kindern. So gibt es immer mehr Mütter, die allein vor der Aufgabe stehen, für ein Kind mit geistiger Behinderung zu sorgen. Es gibt zwei Erklärungen für dieses Phänomen. Die wichtigste Erklärung, die vor allem auch die jüngeren Kinder trifft, ist die Scheidungsrate. Die zweite Erklärung ist, dass geistig behinderte Kinder länger bei ihren Eltern wohnen, oft bis ins hohe Erwachsenenalter. Durch vielerlei Faktoren veranlasst, unter anderem durch das Fehlen geeigneter Wohnmöglichkeiten für die behinderte Tochter oder den behinderten Sohn, findet der Ablösungsprozess später oder gar nicht statt. Dies bedeutet, dass in einigen Fällen das erwachsene geistig behinderte Kind in der Familie verbleibt – auch noch im hohen Alter oder wenn ein Elternteil verstorben ist. Die höhere Lebenserwartung von Menschen mit geistiger Behinderung hat unter anderem zur Folge, dass diese viel häufiger als früher ihre Eltern überleben (Haveman & Stöppler, 2004).
Die bis jetzt beschriebenen sozial-demographischen Trends haben verschiedene Konsequenzen:
- Die Anzahl der alleinerziehenden Eltern nimmt zu.
- Die Periode, in der die Familie für das behinderte Kind verantwortlich sein kann, ist länger.
- Die Geschwister stehen in einem intensiveren Kontakt zu dem behinderten Bruder oder der behinderten Schwester.
- Es gibt weniger Kernfamilienmitglieder (Geschwister, geschiedene Ehepartner), die die Versorgungsrolle der Mutter übernehmen wollen/können.
Die zunehmende Erwerbstätigkeit der Mütter hat zwei weitere Konsequenzen:
- Die Mütter haben weniger Zeit für Erziehungsaufgaben. Väter sind mehr gefragt, im Haushalt und in der Erziehung Aufgaben zu übernehmen.
- Familien sind für die Versorgung, Begleitung und Erziehung ihres Kindes mehr auf das informelle (z. B. Großeltern) oder professionelle soziale Umfeld (z. B. Familienunterstützende Dienste) angewiesen.
In vielen Familien sind es die Großeltern, die versuchen, einen Teil der Belastungen aufzufangen. Müller-Zurek (2002) nennt allerdings drei Faktoren, die eine einschränkende Rolle spielen:
- In der mobilen Gesellschaft leben die Großeltern oft weit entfernt.
- Moderne Großmütter sind häufig berufstätig.
- Die Kräfte der Großeltern lassen nach (ebd., 33).
Die Erwerbstätigkeit der Mutter hat also in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen: 43 Prozent aller Mütter mit Kindern unter 15 Jahren in den alten und 70 Prozent in den neuen deutschen Bundesländern sind erwerbstätig. Vor allem bei Frauen, deren Kinder das Schulalter erreicht haben, ist die Erwerbsquote in den vergangenen zwei Jahrzehnten kräftig gestiegen. Verglichen mit der Generation ihrer Mütter treten die jüngeren westdeutschen Frauenjahrgänge zwar erst in einem höheren Alter ins Berufsleben ein, bleiben dann aber auch als Mütter häufiger erwerbstätig beziehungsweise unterbrechen kürzer.
Der Anstieg dieser Müttererwerbsquote in den alten Bundesländern geht fast ausschließlich auf eine Zunahme der Teilzeittätigkeiten und geringfügigen Beschäftigungen zurück. Der Anteil der in Vollzeit erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter 18 Jahren hat sich gegenüber den 1970er Jahren sogar etwas verringert (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 1999, 109). In der Familienphase mit Kindern im Kindergarten- und Schulalter ist es im Westen Deutschlands dadurch zu einer quantitativen Verlagerung vom Modell der...








