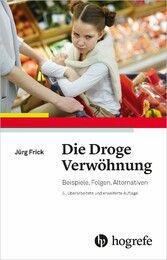
Die Droge Verwöhnung - Beispiele, Folgen, Alternativen

von: Jürg Frick
Hogrefe AG, 2018
ISBN: 9783456957463
Sprache: Deutsch
256 Seiten, Download: 2410 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
2 Was heißt Verwöhnung? Die begrifflich-phänomenologische Ebene (S. 27-28)
In der akademischen Psychologie sowie in der Pädagogik als Erziehungswissenschaft findet sich der Begriff „Verwöhnung“ kaum. Und der englische Begriff overprotection deckt auch nur – und ungenau – einen Teil des Verwöhnungsproblems ab.
Die Erziehungsstil-Forschung der vergangenen Jahrzehnte (z. B. Lewin, Tausch und Tausch, Anderson, Schmidtchen u. a.) beschreibt Erziehungsstile, ohne die Verwöhnung explizit zu erwähnen. Manchmal werden noch der „permissive Erziehungsstil“ (Maccoby & Martin, 1983 in Perlet & Ziegler, 1999) oder der „überbehütende Erziehungsstil“ (Kruse, 2001 in Walper & Pekrun, 2001) erwähnt und beschrieben – meistens allerdings nur kurz. Auch im Überblicksband von Weber (1986) findet sich kein Wort dazu. In keinem dieser Erziehungsstil-Modelle erkennt man Praktiken, die verwöhnende Aspekte ausführlicher enthalten. Das ist doch eher erstaunlich, da das Phänomen Verwöhnung schon seit langem in der Theorie (vgl. z. B. bei Adler), in der Alltagssprache wie auch in der pädagogischen Praxis (Erziehung, Schule) bekannt ist. Vielleicht hängt diese Amnesie mit den zum Teil eher theoretisch entwickelten Konzepten der Erziehungsstil-ForscherInnen zusammen.
Nach Hobmair bezeichnet ein „Erziehungsstil die Art und Weise, wie ein Erzieher dem zu Erziehenden gegenübertritt. Dabei handelt es sich um relativ konstante Verhaltensweisen des Erziehers gegenüber dem zu Erziehenden […] Erziehungsstil kennzeichnet also eine durchgängige Grundhaltung des Erziehers.“ (Hobmair et al., 1996, S. 212) Diese Definition lässt sich sehr genau auf die Verwöhnung übertragen: Verwöhnung ist ebenfalls – wie ich gleich zeigen werde – eine Grundhaltung der betreffenden Eltern oder Lehrperson, die mehr oder weniger konstant und anhand bestimmter Kriterien identifizierbar ist. Verwöhnung ist eine eigene Variante eines Erziehungsstils, so wie in der Literatur etwa ein kooperativer, ein autoritärer, ein Laisser-faire-Stil (Lewin) oder eine Dimensionenkombination (Tausch und Tausch) beschrieben worden sind.
Hobmair spricht in seinem Lehrbuch der Pädagogik nur einmal von einem überbehütenden Stil (Hobmair et al, 1996, S. 222), der nach Tausch und Tausch eine sehr hohe Lenkung sowie eine maximale Wertschätzung beinhalten soll. Leider geht er darauf nicht näher ein. Ich möchte das in diesem Kapitel nachholen. Verwöhnung beinhaltet mehr und zum Teil anderes als nur sehr hohe Lenkung und maximale Wertschätzung, und Verwöhnung lässt sich auch nicht auf diese zwei Dimensionen reduzieren. Der verwöhnende Erziehungsstil hat auch wenig mit Laisser-faire oder Permissivität (Gewährenlassen) zu tun. In Heilbruns Kontrollmuster-Modell werden zwei Hauptdimensionen (niedrige vs. hohe Unterstützung, niedrige vs. hohe Kontrolle) unterschieden. Die Kombination von hoher Kontrolle mit hoher Unterstützung wird dort mit überbehütend (engl. overprotective) bezeichnet. Ich halte dieses Konzept bezüglich der Verwöhnung für ungenau, da beim verwöhnenden Erziehungsstil die Unterstützung aus der psychologischpädagogischen Perspektive eben gerade nicht hoch ist: Eine echte hohe Unterstützung würde vielmehr bedeuten, dem einzelnen Kind die persönlichkeits-, situations- und altersspezifisch optimale, nicht einfach „hohe“, Unterstützung zukommen zu lassen. Hohe, also optimale, Unterstützung würde dann sehr spezifisch – sich an den Bedürfnissen und Möglichkeiten des einzelnen Kindes und Jugendlichen orientierend – manchmal hoch, dann tief, später vielleicht mittel ausfallen, je nach Situation und Person (vgl. Krohne & Hock, 1994).
Von Cubes verhaltensbiologische Definition – „Unter Verwöhnung verstehe ich eine rasche und leichte Triebbefriedigung – mit dem damit verbundenen Lusterlebnis – ohne Anstrengung.“ (Cube, 1999, S. 15) – lenkt das Augenmerk stark auf triebgeleitete Aspekte. Wunschs Beschreibung von Verwöhnung berücksichtigt dagegen stärker eine psychologisch orientierte Sichtweise: „Verwöhnung ist das Resultat unangemessenen Agierens oder Reagierens auf Wünsche oder Verhalten.“ (Wunsch, 2000, S. 83) Und etwas später schreibt er treffend: „Verwöhnung vollzieht sich durch die Erfüllung bzw. Weckung lebensbehindernder Bedürfnisse, konkret durch zuviel oder zu wenig Gewährenlassen oder durch unangemessenes Agieren und Reagieren.“ (S. 87) Schließlich gibt Wunsch noch eine direktere Beschreibung von Verwöhnung: „Wer einem Menschen Lob, Geld, soziale Anerkennung oder andere Zuwendungen ohne eigenen Beitrag – und sei er noch so klein – auf Dauer zukommen lässt, der verwöhnt.“(S. 154) In diesen drei Zitaten Wunschs sehen wir deutlich zwei Aspekte: Verwöhnung ist eine Handlung sowie eine Haltung von Erwachsenen. Auf beides möchte ich näher eingehen.







