
Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
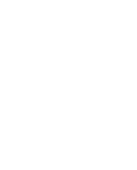
von: Erhard Fischer, Reinhard Markowetz, Ulrich Heimlich, Joachim Kahlert, Reinhard Lelgemann
Kohlhammer Verlag, 2016
ISBN: 9783170242494
Sprache: Deutsch
340 Seiten, Download: 4196 KB
Format: EPUB, PDF, auch als Online-Lesen
Zur endlosen Geschichte der Verweigerung uneingeschränkter Teilhabe an Bildung – durch die Geistigbehindert-Macher und Kolonisatoren1
Georg Feuser
Achille Mbembe (2014) verdeutlicht mit Verweis auf eine Arbeit von Frantz Fanon zur Frage: »Pourqu[o]i nous employons la violance« darauf, dass der zeitliche Fortbestand eines durch Gewalt etablierten Systems von der Aufrechterhaltung der Gewalt abhängt und stellt fest:
»Diese Gewalt besitzt drei Dimensionen. Sie ist »Gewalt im alltäglichen Verhalten« des Kolonisators gegen den Kolonisierten; sie ist »Gewalt gegen die Vergangenheit« des Kolonisierten, die »bar jeder Substanz« ist; und sie ist Gewalt und Affront gegen die Zukunft, »da das Kolonialsystem sich als ewig darstellen muss« (199/200).
1 Narration
Es war wenige Wochen vor Ende des Zeiten Weltkrieges, als meine Großmutter, meine Mutter und ich aus der Stadt nahe am Rhein in das kleine, nicht einmal ganz 800 Bewohner zählende Dorf am Rande des nördlichen Schwarzwaldes zurückgingen, in dem meine Eltern eine Wohnung hatten und mein Vater, ehe er zum Militärdienst eingezogen wurde, arbeitete. Seit meiner Geburt bis wenige Wochen vor Ende des Krieges lebten wir bei meinen Großeltern. Aber dort war vor allem der Granatbeschuss zu groß geworden. Bald hingen aus allen Fenstern des Dorfes weiße Leintücher als Zeichen dafür, dass die Bewohner sich widerstandslos den heranrückenden Alliierten ergeben und den Ort an die entsprechende Kommandantur übergeben würden. Das war eine spannende Sache. Es kamen viele bewaffnete Männer in einem langen Zug durch den Ort, von denen viele eine dunkle Hautfarbe hatten; »Neger« seien das, sagte man im Haus, und gefährliche Wilde. Die Karren und Geschütze wurden von Maultieren gezogen und schwere Lasten von ihnen getragen; auch Maschinengewehre. Mein Interesse war so groß, dass mich meine Großmutter auf den Arm nahm, den Vorhang zur Seite schob, damit ich besser sehen konnte, was draußen auf der Straße in der Dorfmitte vor sich ging. Einer der Soldaten hob das Gewehr und schoss durch die Scheibe haarscharf an uns vorbei.
Die erste Zeit blieben wir in der Wohnung und verhielten uns so ruhig es nur ging. Ich war sehr erschrocken, erinnere mich aber, dass es in mir keine Furcht vor dem »schwarzen Mann« auslöste, mit dem uns Kindern, waren wir unartig, stets im Zusammenhang mit dem Einsperren in ein dunkles Kellerloch gedroht wurde. Mir war der Unterschied zwischen dieser Drohgestalt und den dunkelhäutigen Soldaten sehr schnell klar geworden. Bald zog diese beeindruckende Karawane wieder ab und Tanks und Jeeps rückten nach – wir waren nun nicht mehr französische, sondern amerikanische Besatzungszone. Die weißen und die schwarzen Soldaten waren sehr gut zu uns. Sie gaben uns zu essen, wir durften auf ihre Fahrzeuge und Panzer klettern, ihre Stahlhelme aufziehen, mit ihnen auf Patrouille gehen – und sie spielten mit uns. Dabei lernte ich einen schon jugendlichen Burschen kennen, dessen vollen Namen ich nie erfahren habe. Er wurde meist nur »der Depp« genannt. Er strich durchs Dorf, ging in die Bauernhäuser, holte sich aus den Küchen etwas zu essen. Auch er wurde von den »Amis« versorgt. Er erregte mein Interesse und ich folgte ihm zum Dorfrand, wo eine große Feld- und Tabakscheune stand. Dort hatte er, in Heu und Stroh vergraben, seine Schlafstätte, seine Vorräte und vor allem seine Kessel und Deckel in unterschiedlichsten Größen, auf denen er oft über Stunden ohne Unterbrechung mit Holzstöcken, die er sich sorgfältig ausgesucht hatte, trommelte. Wir freundeten uns an. Er mied mich nicht mehr wie die anderen Leute, denen er auswich, und wenn ich bei ihm wider das Gebot, dass man nicht mit ihm gehen und schon gar nicht mit ihm zusammen sein solle, weil das gefährlich sei, bei ihm auftauchte, ließ er zu, dass ich mitmachte. Er sagte nicht ›Guten Tag‹, wenn ich kam, nicht ›Ade‹, wenn ich ging, und auf meine Frage, wie er den heiße, vermeinte ich, ›Karl‹ zu hören. So nannte ich ihn fortan und viele im Dorf übernahmen das. Ich habe ihn nie sprechen gehört, aber ich hatte auch nie den Eindruck, dass wir uns deshalb nicht verstehen würden. Wir konnten uns alles mitteilen und einander verstehen – sehr gut sogar. Er machte interessante Töne zu seinem Trommeln. Manchmal half er in einem Stall, im Garten, auf dem Feld, bei wem auch immer.
Es gab noch einen Menschen im Dorf. Er wurde der »Polack« genannt. Er arbeitete bei einem Bauern von früh an bis spät in die Nacht hinein, Tag für Tag und zwischendurch füllte er Wasser in Glasflaschen und gab eine Tablette dazu, die das Wasser sprudeln ließ. Manche Tabletten machten das Wasser grün und ließen es wie Waldmeister schmecken, den wir auch am Waldrand sammelten. Mit dem »Polacken« konnte man spielen, ihm bei seiner Arbeit helfen und ich bekam oft eine Flasche Wasser für den »Deppen«. Die leeren Flaschen brachte ich ihm wieder zurück. Ich hörte, dass er ein polnischer Kriegsgefangener war, der schon bald nach Beginn des Krieges ins Dorf gebracht wurde und auf dem Hof eines Bauern arbeiten musste. Mit ihm sprachen die Erwachsenen nicht. Vom Bauern bekam er sein Essen und schlafen musste er in der Scheune wie der »Depp«. Damals begriff ich nicht, warum man auch zu uns Kindern »Polacken« sagte, wenn wir uns nicht ordentlich verhielten, von der Arbeit aufsahen oder auch mal von dieser wegliefen oder müde waren, was nach sich zog, dass wir als faul, »Nichtsnutze«, und »Tagediebe« beschimpft und manche von uns deswegen auch geschlagen wurden. Wenn es auf den Feldern viel zu tun gab, mussten wir dort arbeiten und hatten keinen Unterricht. Der »Depp« brauchte nicht zur Schule gehen. Er würde dort ohnehin nichts lernen und nur stören, sagte man.
Zeitsprung: Am 20. Juni 1948 ging ich in großer Angst, etwas falsch zu machen, ins Rathaus und holte das neue Geld ab, für meine Mutter, meinen inzwischen aus der Gefangenschaft heimgekehrten Vater und für mich. Es waren für jeden von uns 40,– DM Kopfgeld. Ich brachte es sicher nach Hause. Wir waren, so meinte ich, nun alle gleich. Dann veränderte sich sehr vieles sehr schnell. Die Sanktionen gegen den Verkehr mit dem »Dorfdeppen« wurden härter, die Scheune wurde für das Unterstellen der neuen Traktoren, Pflüge, Eggen, Säh- und Erntemaschinen benötigt, für das Trocknen von Tabak und Lagern von Schweine- und Viehfutter für den Winter. Er musste weichen, hatte kein Zuhause mehr. Wenn er sich etwas zu Essen besorgte, wurde er verjagt. Einmal, er muss sehr hungrig gewesen sein, warf er mit einem Messer, das herumlag, nach einer Person, die ihn stellen wollte und wurde auf dem Rathaus angezeigt. Die Polizei kam und man sagte nun, dass er ein Gewalttätiger sei, ein Gefährlicher, ein Krimineller, vor dem alle geschützt werden müssen.
Meine Erinnerung verweist mich auf den Anfang der 1950er Jahre. Der neue Unterschlupf des »kriminellen Deppen«, den mir der »Polack« verraten hatte, war eines Tages leer. Nur Kleinigkeiten, die ich noch fand, kündeten von ihm. Er war auch am nächsten Tag nicht mehr aufzufinden, auch tags darauf nicht. Mein Freund war plötzlich verschwunden. Ich erfuhr nach mühsamen Nachfragen, mit denen ich die Erwachsenen nervte, man habe ihn nach Wiesloch2 gebracht, weil er ein Idiot sei, geistigbehindert. Diesen Begriff hörte ich damals das erste Mal. Aber der Namen dieses Ortes war bald häufiger zu hören. Dorthin kamen Leute, die man als Verrückte oder Blöde bezeichnete, auch solche Männer, die aus dem Krieg zurückgekehrt waren und ihren Bauernhof nicht mehr bewirtschaften konnten. Man nannte sie »Krüppel«. Ich sah oft, wie sie sich bei einem lauten Knall wegen der Fehlzündung eines Motors auf den Boden warfen, die Hände in die Erde krallten und sich an diesen pressten und lange nicht mehr aufstehen konnten. Auch Erika kam dorthin. Nachts, bei der Arbeit auf den Feldern, wenn man nur den Mond als Lichtquelle hatte, sagte sie oft: »Geh’ mir aus dem Mond, ich kann nichts sehen.« Später hatten die Maschinen, vor allem die Mähdrescher, mit denen auch in der Nacht gearbeitet wurde, grelle Schweinwerfer, die ringsum alles beleuchteten.
Der Polack entschied sich, im Dorf zu bleiben. Seine gesamte Familie, so erfuhr er, war den Nazis, im Widerstand gegen sie, zum Opfer gefallen. Er unterschied sich ohnehin kaum noch von den Menschen im Dorf, wenn er arbeitete, und reden tat er nicht; nur mit...









