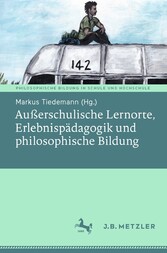
Außerschulische Lernorte, Erlebnispädagogik und philosophische Bildung

von: Markus Tiedemann
J.B. Metzler, 2021
ISBN: 9783476057709
Sprache: Deutsch
555 Seiten, Download: 6742 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
| Vorwort | 6 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 8 | ||
| Herausgeber- und Autorenverzeichnis | 11 | ||
| Teil I Theoretisch konzeptionelle Ebene 1: Die philosophische Perspektive | 17 | ||
| Außerschulische Lernorte, Erlebnispädagogik und philosophische Bildung: Selbstverständnisse und Kompatibilität | 18 | ||
| Zusammenfassung | 18 | ||
| 1 Begriffliche Bestimmungen | 19 | ||
| 2 Außerschulische Lernorte | 19 | ||
| 2.1 Erlebnispädagogik | 23 | ||
| 2.2 Historische Bestimmung | 24 | ||
| 2.3 Philosophische Bildung | 29 | ||
| 3 Kompatibilität | 31 | ||
| 3.1 Sinnlichkeit, Bewegung, Lokalität und Nachdenklichkeit | 31 | ||
| 3.2 Das Prinzip der Ganzheitlichkeit und die Essenz philosophischer Bildung | 32 | ||
| 3.3 Philosophische Reflexion als Dienst an der Erlebnispädagogik und Gewinn für außerschulische Lernorte | 35 | ||
| 3.4 Methodisch-praktische Ebene | 37 | ||
| 4 Zusammenfassung | 39 | ||
| Literatur | 40 | ||
| Philosophie der Verortung und Verortung der Philosophie | 43 | ||
| Zusammenfassung | 43 | ||
| 1 Wo sind wir, wenn wir denken? | 44 | ||
| 2 Der philosophiegeschichtliche Kontext | 45 | ||
| 2.1 Antike: topos und ch?ra | 47 | ||
| 2.2 Neuzeit: Verlust des Ortes | 49 | ||
| 2.3 Wiederaufstieg des Ortes in der Phänomenologie | 51 | ||
| 3 Einige Kerngedanken einer Philosophie des Ortes | 52 | ||
| 3.1 Ort und Raum | 52 | ||
| 3.2 Topographie und Triangulation | 54 | ||
| 4 Verortung als Bedingung der menschlichen Existenz – ein Fazit | 56 | ||
| Literatur | 58 | ||
| Peripatetisches Philosophieren | 60 | ||
| Zusammenfassung | 60 | ||
| 1 Einleitung | 61 | ||
| 2 Was ist Peripatetisches Philosophieren? | 62 | ||
| 3 Peripatetisches Philosophieren als Lern- und Unterrichtsform der Gegenwart | 63 | ||
| 4 Die vier Säulen peripatetischen Philosophierens | 64 | ||
| 4.1 Tradition | 65 | ||
| 4.2 Kognition | 71 | ||
| 4.3 Lokomotion | 74 | ||
| 4.4 Situation | 77 | ||
| 5 Fazit | 80 | ||
| 6 Aktuelle Entwicklungen und Ausblick | 81 | ||
| Literatur | 84 | ||
| Bildung im Medium der Ästhetik. Die Aktualität von Schillers Theorie der ästhetischen Bildung im Zeitalter der Digitalisierung | 87 | ||
| Zusammenfassung | 87 | ||
| 1 Schillers Gesellschafts- und Kulturkritik als Motiv seiner ästhetischen Theorie | 89 | ||
| 2 Die Antinomien der Moderne und die kompensatorische Wirkung der Kunst | 93 | ||
| 3 Schillers Theorie der Geschmacksbildung | 97 | ||
| 4 Die Aktualität Schillers | 100 | ||
| Literatur | 104 | ||
| Teil II Theoretisch konzeptionelle Ebene 2: Die erlebnispädagogische Perspektive | 105 | ||
| Erlebnispädagogik und schulische Bildung | 106 | ||
| Zusammenfassung | 106 | ||
| 1 Rückblicke: Zwischen Raffael und Rousseau | 107 | ||
| 2 Rundblicke: Kurt Hahn – von Aberdovey bis Zimbabwe | 108 | ||
| 3 Einblick: Erlebnispädagogik – Annäherungen an einen schwierigen Begriff | 109 | ||
| 4 Überblick: Erlebnispädagogik und schulische Bildung | 110 | ||
| 5 Project Adventure | 111 | ||
| 5.1 Erlebnispädagogische Klassenfahrten | 111 | ||
| 5.2 Die „Herausforderung“ | 113 | ||
| 5.3 Spiele und Lernprojekte | 114 | ||
| 5.4 Outdoor Education bzw. Draußenschule | 116 | ||
| 5.5 Aktivierende Methoden | 117 | ||
| 5.6 Bewegter Unterricht | 118 | ||
| 5.7 Weiterbildung Erlebnispädagogik | 120 | ||
| 6 Ausblicke | 121 | ||
| Literatur | 122 | ||
| A Place-Binding Knot Map. Phronêsis as Outdoor Learning | 125 | ||
| Abstract | 125 | ||
| 1 Bearing: Unfurling | 126 | ||
| 2 Bearing/Charting: Yarn Explained/Unspooled | 128 | ||
| 3 Bearing: Outdoor Guiding | 131 | ||
| 4 Bearing: Adventure | 132 | ||
| 5 Bearing: Getting Lost and Maps | 132 | ||
| 6 Bearing: Kairós—Tópos—Phronêsis | 136 | ||
| 7 Bearing: Practical Wisdom and Learning in the Open | 140 | ||
| 8 Bearing: Stance, Balance and Bearings and Outdoor Movement | 143 | ||
| 9 Bearing: States of Matter Matter | 146 | ||
| 10 Bearing: Wherewithal and Risking Phronêsis as Outdoor Learning | 147 | ||
| 11 Wrapping Up Yarn/Plotting Bearings: On the Spool and Bearing Down | 152 | ||
| References | 153 | ||
| Teil III Exemplarische Lernorte 1: Museen, kulturelle Einrichtungen und Gedenkstätten | 156 | ||
| Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven. Ein Migrationsmuseum als außerschulischer Lernort | 157 | ||
| Zusammenfassung | 157 | ||
| 1 Überblick | 158 | ||
| 2 Die Vermittlung von Migrationsgeschichte | 158 | ||
| 2.1 Immersive Vermittlung: Inszenierungen und Virtual Reality | 162 | ||
| 3 Perspektivwechsel: Biographische und familiäre Narrative | 165 | ||
| 4 Bildungsprogramme | 166 | ||
| 5 Kooperation mit der philosophischen Bildung | 167 | ||
| 6 Ausblick | 168 | ||
| Literatur | 169 | ||
| Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden | 171 | ||
| Zusammenfassung | 171 | ||
| 1 Die architektonische Wirkung in der Dauerstellung | 172 | ||
| 2 Veranstaltungen | 174 | ||
| 3 Geschichte der Bundeswehr/Historische Bildung | 175 | ||
| 4 Pädagogische Vitrinen | 176 | ||
| 5 Bedeutung für Soldaten | 177 | ||
| 6 Vielfalt im Museum und pädagogische Angebote | 178 | ||
| 7 Kooperationen mit der philosophischen Bildung | 181 | ||
| Literatur | 182 | ||
| Theaterpädagogik am Staatsschauspiel Dresden | 183 | ||
| Zusammenfassung | 183 | ||
| 1 Das Staatsschauspiel Dresden als außerschulischer Lernort | 184 | ||
| 2 Theatrales Philosophieren – ein Überblick | 186 | ||
| 3 Projektbeispiel HOOL | 192 | ||
| 3.1 Informationen zur Inszenierung | 192 | ||
| 3.2 Los geht’s! – Vor- und nachbereitende Übungen für das theatrale Arbeiten | 194 | ||
| 3.3 Vom Eindruck zur philosophischen Fragestellung | 195 | ||
| 3.4 Philosophieren im Theater – Theaterspielen im Philosophieunterricht | 197 | ||
| Literatur | 200 | ||
| ERSTMAL AUFREGEN. Kunst, Philosophie und selbstmotiviertes Lernen im Museum | 202 | ||
| Zusammenfassung | 202 | ||
| 1 Aufregen | 202 | ||
| 2 Aufräumen | 206 | ||
| 3 Betrachten | 209 | ||
| 4 Reden | 213 | ||
| 5 Gestalten | 216 | ||
| Literatur | 218 | ||
| Der Zoo als Lernort | 220 | ||
| Zusammenfassung | 220 | ||
| 1 Aufgaben moderner Zoologischer Gärten und Aquarien | 221 | ||
| 2 Was ist Zoopädagogik? | 222 | ||
| 2.1 Formelle und Informelle Lernangebote | 223 | ||
| 2.2 Lerninhalte | 227 | ||
| 2.3 Fächerübergreifende Lerninhalte | 231 | ||
| 2.3.1 Verflechtungen von Biologie, Kunst, Mathematik und Sprachen | 231 | ||
| 2.3.2 Ethik und Philosophie im Zoo | 232 | ||
| 2.3.2.1 Philosophie trifft Kognitionsforschung | 233 | ||
| 2.3.2.2 Das Verhältnis vom Mensch zum Tier | 235 | ||
| 3 Fazit | 236 | ||
| Literatur | 236 | ||
| Teil IV Exemplarische Lernorte 2: Gesellschaftliche Institutionen | 238 | ||
| PeerMediation hinter Gittern. Ein Projekt zur Gewaltprävention und konstruktiven Konfliktbearbeitung in der Jugendstrafanstalt Berlin | 239 | ||
| Zusammenfassung | 239 | ||
| 1 Konflikte sind überall | 241 | ||
| 2 Konfliktfähigkeit will gelernt sein | 241 | ||
| 3 Konstruktive Konfliktlösung | 242 | ||
| 4 Die PeerMediationsausbildung | 243 | ||
| 5 PeerMediation hinter Gittern | 245 | ||
| 6 Verankerung und Nachhaltigkeit | 246 | ||
| 7 Herausforderungen | 250 | ||
| 8 Kooperation mit externen Partnern | 251 | ||
| Literatur | 253 | ||
| Hospiz ist kein Ort, sondern eine Haltung | 254 | ||
| Zusammenfassung | 254 | ||
| 1 Die Hospizidee | 255 | ||
| 2 Das Projekt „Hospizlernen“ | 255 | ||
| 2.1 Hospizlernen I: Gib mir’n kleines bisschen Sicherheit//Hospizprojekte für Kinder und Jugendliche | 257 | ||
| 2.1.1 Erster Aspekt: Ehrenamtlichkeit | 258 | ||
| 2.1.2 Zweiter Aspekt: Vielfältige Lebens- und Sozialräume | 258 | ||
| 2.1.3 Dritter Aspekt: Kein Projekt nach Schema F – dynamisch und individuell | 258 | ||
| 2.1.4 Herzens- und Haltungsbildung | 259 | ||
| 2.2 Hospizlernen II: Hospiz macht Schule//Ein Konzept für Schüler*innen der 3. und 4. Klasse | 260 | ||
| 2.2.1 Exkurs: Didaktik und Methoden von Hospiz macht Schule | 261 | ||
| 2.3 Hospizlernen III: Endlich. – Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Ein Konzept für Schüler*innen der Jahrgangsstufen 9 bis 13 | 262 | ||
| 2.4 Hospizlernen IV: Leben, Sterben, Tod und Trauer in der Schule/Fortbildung für Pädagog*innen | 264 | ||
| 2.5 Kindern und Jugendlichen neue Räume eröffnen | 265 | ||
| 2.5.1 Ein Tag im Hospiz | 265 | ||
| 3 Hospiz – ein Thema für die Lehrpläne? | 266 | ||
| 3.1 Auch eine Möglichkeit: Sozial- und Berufspraktika | 268 | ||
| 4 Die Hospizidee in das Leben hinaustragen | 269 | ||
| 5 Weitere Informationen | 269 | ||
| 5.1 Hospizlernen/Hospiz macht Schule | 269 | ||
| 5.2 Gib mir’n kleines bisschen Sicherheit//Hospizprojekte für Kinder und Jugendliche | 270 | ||
| 5.3 Endlich. – Umgang mit Sterben, Tod und Trauer//Ein Projektunterricht für Schüler*innen der Jahrgangsstufen 9 bis 13 | 270 | ||
| 5.4 Leben und Sterben, Krankheit und Tod in der Schule/Seminarangebote der Deutschen Kinderhospizakademie für Lehrer*innen und pädagogische Fachkräfte | 271 | ||
| Literatur | 271 | ||
| pro familia. Ethisch-philosophische Aspekte Sexueller Bildung | 272 | ||
| Zusammenfassung | 272 | ||
| 1 Sexualität: Mehr als Sex | 273 | ||
| 2 pro familia: Selbstbestimmte Sexualität als Menschenrecht | 274 | ||
| 3 Ethische Fragestellungen in der sexualpädagogischen Bildungsarbeit | 276 | ||
| 3.1 Ethisch-philosophische Fragestellungen in der kulturell-gesellschaftlichen und politischen Dimension | 276 | ||
| 3.2 Ethisch-philosophische Fragestellungen in der personalen Dimension | 277 | ||
| 3.3 Ethisch-philosophische Fragestellungen in der zwischenmenschlichen Dimension | 278 | ||
| 4 Methodische Umsetzung Sexueller Bildung zu philosophischen Fragestellungen | 279 | ||
| 4.1 Übung zur Sprachfähigkeit | 279 | ||
| 4.2 Übung zur Grenzwahrnehmung | 280 | ||
| 4.3 Übung zur Selbstreflexion | 281 | ||
| 5 Haltung und Arbeitsweise der Leitung | 282 | ||
| Literatur | 283 | ||
| Das Förderzentrum „Clemens Winkler“ und die Einbeziehung von Projektarbeit und außerschulischen Lernorten | 285 | ||
| Zusammenfassung | 285 | ||
| 1 Das Förderzentrum „Clemens Winkler“ | 285 | ||
| 2 Angebote und Programme | 287 | ||
| 2.1 „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ | 289 | ||
| 2.2 „Was geht mich denn die Geschichte an?“ – Ganztagsangebot für Schüler der Klassen 5 und 6 | 290 | ||
| 2.3 Jüdisches Leben in Sachsen – Ethikunterricht der Klasse 6 in Zusammenarbeit mit dem Verein HATiKVA e. V., Dresden | 292 | ||
| 3 Anforderungen an einen Kooperationspartner | 294 | ||
| Literatur | 294 | ||
| Teil V Exemplarische Lernorte 3: Sakrale und meditative Orte | 295 | ||
| Interreligiöse Begegnung als selbstreflexiv-spirituelle Erfahrung – Tag der offenen Moschee als religionspädagogische Praxis | 296 | ||
| Zusammenfassung | 296 | ||
| 1 „Tag der offenen Moschee“ (TOM) – eine Initiative zur Begegnung | 298 | ||
| 1.1 Moscheegemeinden (nicht mehr) als „Zuhause in der Fremde“ | 298 | ||
| 1.2 Der TOM und das Selbstbewusstsein der Muslime in Deutschland | 299 | ||
| 2 „Liebe Kinder! Heute besuchen wir die Moschee!“ | 302 | ||
| 2.1 Die Moschee als Erlebnisort | 302 | ||
| 2.2 Möglichkeiten und Grenzen des TOM | 305 | ||
| 3 Begegnung und Bildung – eine theologische Reflexion | 308 | ||
| Literatur | 313 | ||
| Moschee als außerschulischer Lernort | 315 | ||
| Zusammenfassung | 315 | ||
| 1 Die Moschee als ein Lernort | 315 | ||
| 2 Moscheebesuche | 318 | ||
| 3 Unterrichtsvorbereitung auf den Moscheebesuch | 320 | ||
| 4 Kooperation mit der philosophischen Bildung | 321 | ||
| 5 Zusammenfassung | 322 | ||
| Literatur | 324 | ||
| „Warum hat Ihre Moschee kein Kreuz?“ Die Neue Synagoge Dresden als außerschulischer Lernort | 325 | ||
| Zusammenfassung | 325 | ||
| 1 „Mein Haus werde genannt ein Haus der Andacht allen Völkern.“ Die Neue Synagoge Dresden | 326 | ||
| 2 „Juden erkennt man am gelben Stern.“ Dazulernen. Potenziale für die Entwicklung von Kompetenzen bei Jugendlichen | 327 | ||
| 3 „Welche Bedeutung hat die Synagoge für die Dresdner?“ Voraussetzungen | 331 | ||
| 4 „Jüdische Mitbürger“ und andere Probleme | 333 | ||
| 5 „Und ich bin Atheistin und fühl’ mich als Jüdin“. Über das Thema Judentum hinaus | 336 | ||
| Literatur | 338 | ||
| Zen und Kontemplation. Raum für spirituelle Wege Berlin | 340 | ||
| Zusammenfassung | 340 | ||
| 1 Einleitung | 341 | ||
| 1.1 Zen | 341 | ||
| 1.2 Kontemplation | 344 | ||
| 1.3 Selbstverständnis des Raum für spirituelle Wege – Zen und Kontemplation | 345 | ||
| 2 Erfahrungen aus der Praxis | 346 | ||
| 2.1 Weiterführende Schulen: Mittel- und Oberstufe | 347 | ||
| 2.2 Grundschulen | 348 | ||
| 3 Chancen und Herausforderungen | 350 | ||
| 3.1 Chancen und mögliche weiterführende Formate | 350 | ||
| 3.2 Herausforderungen | 355 | ||
| 4 Zusammenfassende Empfehlungen für Beteiligte | 356 | ||
| 4.1 Schüler*innen | 356 | ||
| 4.2 Pädagog*innen | 357 | ||
| 4.3 Spirituelle Zentren | 358 | ||
| Literatur | 359 | ||
| Teil VI Exemplarische Lernorte 4: Erlebnispädagogik und Outdoor Education | 361 | ||
| Alpine Erlebnispädagogik: Die Berge als Lernort | 362 | ||
| Zusammenfassung | 362 | ||
| 1 Berge und Pädagogik | 362 | ||
| 2 Alpine Erlebnispädagogik | 365 | ||
| 3 Weniger kann mehr sein: Gestaltung minderstrukturierter Aktivitäten | 366 | ||
| 3.1 Grenzen | 370 | ||
| 3.2 Barrieren und Hindernisse | 370 | ||
| 3.3 Übergänge | 371 | ||
| 3.4 Orte | 372 | ||
| 3.5 Zeit | 372 | ||
| 4 Kooperationen mit philosophischer Bildung | 373 | ||
| 5 Fazit | 373 | ||
| Literatur | 374 | ||
| OUTWARD BOUND – Lernen mit Kopf, Herz und Hand | 375 | ||
| Zusammenfassung | 375 | ||
| 1 Entwicklung und Selbstbild | 376 | ||
| 1.1 Entstehung von Outward Bound | 376 | ||
| 1.2 Von der Kurzschule zum Bildungspartner | 377 | ||
| 1.3 Die Arbeit von Outward Bound | 377 | ||
| 1.3.1 Das Selbstverständnis von Outward Bound | 377 | ||
| 1.3.2 Der Wertekompass | 378 | ||
| 1.3.3 Methodische Grundprinzipien der Arbeit | 380 | ||
| 1.3.4 Outward Bound und Ethik – Philosophie | 383 | ||
| 2 Outward Bound Germany aktuell | 384 | ||
| 2.1 Programme für junge Menschen | 384 | ||
| 2.1.1 Klassenfahrten | 384 | ||
| 2.1.2 Einzelanmelderprogramme | 386 | ||
| 2.2 Academy und Lehrerfortbildung | 387 | ||
| 3 Fazit und Ausblick | 387 | ||
| Literatur | 387 | ||
| Wildnispädagogik in der Naturschule Wildniswandern | 389 | ||
| Zusammenfassung | 389 | ||
| 1 Was ist Wildnispädagogik? | 390 | ||
| 2 Zur Herkunft | 390 | ||
| 3 Lernformate und -orte | 391 | ||
| 4 Das Ziel der Mentoren | 392 | ||
| 5 Die Tore für Beziehungen | 395 | ||
| 6 Die Fragen des Kojoten | 399 | ||
| 7 Das Rad des Lernens | 401 | ||
| 8 Ein lebensförderliches Weltbild | 404 | ||
| 9 Ermunterung zur Praxis | 407 | ||
| Literatur | 407 | ||
| Wald macht Schule | 409 | ||
| Zusammenfassung | 409 | ||
| 1 Einleitung | 410 | ||
| 2 Der Blick zurück geht in die Natur – Wald WAR Schule | 410 | ||
| 3 Lernen ohne Natur – Schule OHNE Wald | 413 | ||
| 4 Besser als ein „Grünes Klassenzimmer“ – Wald IST Schule | 415 | ||
| 5 Waldpädagogik heute – Lernen unter vielen Bäumen | 416 | ||
| 6 BNE – Nachhaltigkeit im Spiegel von Naturentfremdung und Globalisierung | 418 | ||
| 7 Wald(pädagogik) als Brücke des Menschen zur Natur | 419 | ||
| 8 Ein Blick in die Zukunft – „Wald MACHT Schule“ | 422 | ||
| 8.1 Waldkindergärten – Wald von Anfang an | 422 | ||
| 8.2 Schulwälder – Wälder für Schüler*innen | 422 | ||
| 8.3 Lebenslanges Lernen im Wald – ein Generationenprojekt wie der Dauerwald | 423 | ||
| 9 Mehr Lernen im Wald – Was ist dafür zu tun? | 424 | ||
| 9.1 Wälder öffnen – Menschen einladen | 424 | ||
| 9.2 Wald auf den (Lehr)plan bringen | 425 | ||
| 9.3 Lehrende und Forstleute als Tandem | 426 | ||
| 9.4 Wald macht Schule – ein Bildungsprogramm als nur ein Beispiel | 427 | ||
| 9.5 Praktische Empfehlungen für schulisches Lernen im Wald | 427 | ||
| 10 Anbindungen zu philosophischer und ethischer Bildung | 430 | ||
| 11 Zusammenfassung | 431 | ||
| Literatur | 432 | ||
| DKV-Sound-Karate im Schulsport aus Schülerperspektive | 434 | ||
| Zusammenfassung | 434 | ||
| 1 Ausgangssituation | 435 | ||
| 1.1 Zur Orientierung | 436 | ||
| 2 Karate und Schulsport | 437 | ||
| 2.1 Karate | 437 | ||
| 2.2 Rechtliche Ausgangslage | 437 | ||
| 2.3 DKV-Soundkarate in Deutschland | 438 | ||
| 2.3.1 Konzeption des DKV-Sound-Karate | 439 | ||
| 2.4 Bezug zum Bildungsplan Baden-Württemberg | 442 | ||
| 3 Die zugrundeliegende Studie | 443 | ||
| 3.1 Zur Auswahl der befragten Schülerinnen und Schüler | 443 | ||
| 3.2 Auszüge aus den Interviews | 444 | ||
| 3.3 Untersuchungsergebnisse | 444 | ||
| 4 DKV-Sound-Karate, Sport- und Ethikunterricht | 449 | ||
| 5 Zusammenfassende Betrachtung | 450 | ||
| Literatur | 452 | ||
| Teil VII Methodisch-praktische Unterrichtsbeispiele | 453 | ||
| Draußen lernen. Mit Grundschulkindern vom Naturerlebnis zur philosophischen Abstraktion | 454 | ||
| Zusammenfassung | 454 | ||
| 1 Einleitung | 454 | ||
| 2 Über die Dialektik der Pflicht zum naturethischen Diskurs mit Kindern | 455 | ||
| 3 Die Lernziele zur erlebnispädagogischen Intervention mit einer Reflexion auf philosophische Fragen | 459 | ||
| 3.1 Die Unterrichtssequenz | 460 | ||
| Literatur | 466 | ||
| Ich werde nicht hassen. Eine theaterpädagogische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Hass und Fromms Theorie einer produktiven Charakterorientierung | 467 | ||
| Zusammenfassung | 467 | ||
| 1 Einleitung | 468 | ||
| 2 Bedingungsanalyse | 469 | ||
| 3 Didaktisch-methodische Analyse | 471 | ||
| 4 Lernziele der Unterrichtseinheit | 479 | ||
| 5 Planung der Unterrichtseinheit | 480 | ||
| Literatur | 493 | ||
| Über das Sterben nachdenken. Das Hospiz als außerschulischer Lernort | 494 | ||
| Zusammenfassung | 494 | ||
| 1 Bedingungsanalyse | 495 | ||
| 2 Sachanalyse | 496 | ||
| 3 Didaktisch-methodische Analyse | 498 | ||
| 4 Lernziele der Lernbereichsplanung | 505 | ||
| 5 Sequenzplanung | 506 | ||
| Literatur | 522 | ||
| Ethische Konzepte im Belastungstest. Mit Angehenden Erzieher*innen am Lernort Gedenkstätte Buchenwald | 523 | ||
| Zusammenfassung | 523 | ||
| 1 Unterrichtseinheit für die Berufsschule unter Einbeziehung der Gedenkstätte Buchenwald | 524 | ||
| 1.1 Bedingungsanalyse | 524 | ||
| 1.2 Didaktisch-methodische Analyse | 524 | ||
| 2 Lernziele | 526 | ||
| 3 Planungstabelle | 527 | ||
| 3.1 Erste Stunde | 527 | ||
| 3.2 Zweite Stunde | 528 | ||
| 3.3 Dritte Stunde | 529 | ||
| 3.4 Vierte Stunde Exkursion zur Gedenkstätte Buchenwald | 531 | ||
| 3.5 Fünfte Stunde | 532 | ||
| 3.6 Sechste Stunde | 533 | ||
| 3.7 Siebte Stunde | 534 | ||
| Literaturverzeichnis | 534 | ||
| Teil VIII Empirisch-kritische Ebene | 535 | ||
| Erste Erhebungen und Forschungsperspektiven | 536 | ||
| Zusammenfassung | 536 | ||
| Exploration. Erlebnispädagogik und das Philosophieren mit Kindern | 543 | ||
| Zusammenfassung | 543 | ||
| 1 Konzeptidee und Vorbereitung | 544 | ||
| 2 Erprobung mit Studierenden, Oberstufenschüler*innen und Grundschulkindern | 545 | ||
| 2.1 Offenes und persönliches Interview | 546 | ||
| 2.2 Offenes, persönliches Interview und standardisierter Fragebogen | 547 | ||
| 3 Die Befragung zur Exkursion Philosophiekurs 11 | 548 | ||
| 4 Offene Beobachtung | 553 | ||
| 5 Fortentwicklung | 554 | ||
| Literatur | 555 |







