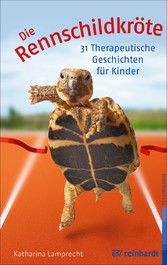
Die Rennschildkröte - 31 Therapeutische Geschichten für Kinder

von: Katharina Lamprecht
ERNST REINHARDT VERLAG, 2020
ISBN: 9783497613403
Sprache: Deutsch
125 Seiten, Download: 1733 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
| 1 Das therapeutische Erzählen |
„Interessante Selbstgespräche setzen einen klugen Gesprächspartner voraus.“ (Walter Whitman)
Therapeutisches Erzählen: Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum?
Einmal fragte mich ein Leser: „Was genau ist eigentlich eine Geschichte“? Ich konnte so spontan keine eindeutige Antwort darauf geben. Meist, wenn wir an Geschichten denken, fallen uns Märchen ein. Oder ein Band mit Kurzgeschichten. Oder erfundene Geschichten, die wir unseren Kindern oder Enkeln sonntags morgens im Bett erzählen. In der Regel verbinden wir mit dem Wort „Geschichte“ eine relativ kurze abgeschlossene Erzählung.
In der Literaturwissenschaft ist eine Geschichte eine mündliche oder schriftliche Schilderung, die auf Tatsachen oder Fiktion beruht.
Nicht nur andere Menschen erzählen mir Geschichten, sondern ich erzähle sie mir auch permanent selbst. Oder genauer, ein Teil von mir erzählt sie einem anderen. Jede Erinnerung, die ich in meinem Kopf abrufe und damit auch neu konstruiere, ist eine Geschichte. Jedes Selbstgespräch, jede Vorstellung von Zukunft, Pläne, die ich mache. Eigentlich fabriziere ich Geschichten am laufenden Band.
Geschichten wurden schon immer erzählt, und zwar lange bevor wir begannen, die Welt zu vermessen. Die australischen Aborigines erschufen ihre Welt sogar, indem sie sie erst erträumten und dann ersangen. Auch in Europa zogen Erzähler durchs Land und sorgten dafür, dass sich mithilfe von Geschichten, Sagen, Mythen und Märchen Wissen und Erfahrungen verbreiten konnten und sich so eine gewisse Orientierung in den frühen Tagen unserer Welt herstellte.
Das Geschichtenerzählen hat eine alte Tradition in allen Teilen der Welt, und die setzt sich bis in die heutige Zeit fort. Wer von uns erinnert sich nicht an die berühmten Märchen der Brüder Grimm, die Erzählungen von Hans Christian Andersen oder Wilhelm Hauff! Interessant ist im Zusammenhang mit Märchen auch, dass sich sehr ähnliche oder gar identische Motive in den Märchen einander völlig fremder Kulturen finden. So begegnen wir auch in der Märchenforschung Psychoanalytikern wie Carl Gustav Jung, der dieses Phänomen mit einem „kollektiven Unbewussten“ zu erklären versuchte, welches besagt, dass alle Menschen eine ähnliche psychische Grundlage haben müssten. So etwas wie ein weltumspannendes psychisches Erbgut. Und da hätten wir schon die ersten Verbindungsfäden zwischen Geschichten und Psychotherapie.
Die Prophetentexte des Alten Testaments, die Gleichnisse Jesu und die Geschichten der Rabbiner verknüpfen Unterhaltung mit spirituellen, pädagogischen und sozialtherapeutischen Anliegen. Durch die gesamte christliche, jüdische und muslimische Geschichte hinweg wurden Metaphern zielgerichtet verwendet, um effektive Impulse zum Lösen von Problemen zu setzen. Eine gut erzählte Geschichte – und denken Sie hier an die jüdischen Witze, die in aller Kürze oft ein ganzes Bündel von Weisheiten beinhalten – kann sich der Aufmerksamkeit der Zuhörer ziemlich sicher sein. Menschen versuchen stets, den Sinn hinter einer Metapher zu erfassen, den Kern des Erzählten zu begreifen und so die darin enthaltene Botschaft zu verstehen.
In dieser schönen Geschichte besucht Mosche seinen Rabbi, weil er wissen möchte, was genau denn eine Alternative sei. Der Rabbi freut sich, weil er mal wieder eine Geschichte erzählen kann und bittet Mosche sich vorzustellen, er habe einen Hahn und eine Henne. Mosche sagt sofort, das sei kein Problem und nun verstünde er, was eine Alternative sei. Aber der Rabbi schüttelt den Kopf und meint, Mosche solle mit Huhn und Hahn in die Eierproduktion einsteigen. Das leuchtet Mosche auch gleich als Alternative ein, denn die Eier kann er ja dann verkaufen. Umso überraschter ist er, als der Rabbi erneut den Kopf schüttelt und vorschlägt, dass, statt mit den Eiern einen schwunghaften Handel zu beginnen, er sie lieber ausbrüten lassen solle, um so eine große Hühnerzucht zu starten. Da strahlt Mosche, bedankt sich beim Rabbi, sagt, nun sei ihm das mit der Alternative so richtig klar und wendet sich ab, um nach Hause zu eilen und Hahn und Henne zu besorgen. Der Rabbi aber hält ihn am Ärmel fest und bedeutet ihm, nicht ganz so schnell zu sein denn, wenn die Hühnerfarm erst mal stünde, käme eine große Flut und alle Tiere würden ersaufen. Mosche ist entsetzt, das sei ja furchtbar, sagt er, die armen, armen Hühner und was soll denn jetzt bitteschön die Alternative sein? Darauf antwortet der Rabbi trocken, das seien doch ganz klar „Enten, lieber Mosche, Enten! (Die Geschichte in aller Länge findet sich z. B. hier: http://www.nlp.de/exp_com/alternative.shtml)
Aber natürlich dienen Märchen und Sagen auch der Unterhaltung und dem Zeitvertreib. Sie geben eine Gelegenheit für das soziale Miteinander, bieten Gesprächsstoff oder verzaubern uns einfach. Und das Ganze ohne Werbeunterbrechungen!
Und was ist nun der Unterschied zwischen einer „normalen“ und einer „therapeutischen“ Geschichte? Was genau sind therapeutische Märchen oder Geschichten? Warum soll man sie erzählen? Was für einen Effekt haben sie? Wer braucht sie? Sind sie nur für Beratungssituationen geeignet oder profitiert jeder davon? Und sind sie ganz grundverschieden von den Märchen und Geschichten, die wir bereits kennen?
Geschichten und Metaphern wirken auf die Seele, denn sie sprechen unsere unbewussten Instanzen an. Es kann sein, dass sie einfach als Beispiele dienen, nach dem Motto: Ach, so könnte ich’s ja auch mal machen. Oft enthalten sie aber, besonders wenn sie für bestimmte Thematiken erzählt werden, implizite Angebote an den Leser oder Zuhörer. Einladungen, sich unbewusst das aus den Geschichten herauszupicken, was für die jeweilige Situation gerade dienlich sein könnte. So kann es passieren, dass man einige Zeit später aus derselben Geschichte ganz andere Bedeutungen herausliest, je nachdem, worauf die eigene Aufmerksamkeit gerade fokussiert ist und wie der aktuelle Lebenskontext sich im Moment gestaltet.
Die Urform aller therapeutischen Geschichten sind unsere Träume. Sie begleiten uns und sind die ursprünglichste Art, mit der wir unser Leben sortieren und nach Lösungen suchen. Im Traum ordnen wir unser psychisches und soziales tägliches Erleben. Unser Kopfkino hilft uns, Eindrücke zu verarbeiten, Fragen zu stellen und Lösungen spielerisch (oder „träumerisch“) zu erproben, mögliche Wege zu prüfen und so, nachts und ganz ohne das Zutun unseres Bewussten, nach Impulsen zu suchen, die uns auf den einen oder anderen Weg bringen können.
Träume lassen sich nach verschiedenen Funktionen einteilen. Es gibt Träume, denen eher eine Suchhaltung zugrunde liegt, wie ein Fischer, der früh am Morgen seine Netze auswirft und nach Krabben, Verzeihung: Lösungen fischt. Es gibt Albträume, die uns vor Gefahren warnen wollen. Und dann gibt es die wunderbaren Träume, die das stärken, was uns als Ressource zur Verfügung steht und im Leben gut gelungen ist, und die lautstark nach „mehr davon“ rufen.
Manche Träume dienen der Nachbereitung, manche der Vorbereitung auf ein Ereignis. Vielleicht haben einige von Ihnen schon erlebt, dass künftige Dinge, wie Prüfungen oder große Feste, zum Beispiel eine Hochzeit, nicht nur ihre Schatten, sondern auch ihre Träume vorausschicken?
Träume und Geschichten sind aber nicht so verschieden, wie wir vielleicht denken. Genauso wie es die verschiedenen Grundformen oder Funktionen von Träumen gibt, gibt es diese bei Metaphern und Erzählungen. Und das lässt sich therapeutisch nutzen. Geschichten repräsentieren die Zielrichtung, Stärkendes zu verstärken, vor Schädlichem zu warnen und sich auf die Suche nach neuen Lebensmöglichkeiten zu machen. Sie regen an nachzudenken, die Gedanken frei und ungezwungen herumspazieren zu lassen und sich auch einmal mit ganz und gar ungewöhnlichen Dingen und Ideen auseinanderzusetzen.
So enthält das Lesen – und Vorlesen – von Geschichten magische Momente. Ganz wie von selbst kann ein Klima erzeugt werden, das eine gewisse Erwartungshaltung begünstigt und Magie in unser Leben lässt. Leser und Zuhörer tragen dazu bewusst und unbewusst bei. Kinder und alte Menschen lassen sich besonders gern verzaubern und in wundersame Welten entführen. So kann das Magische zwischen allen Beteiligten hin und her schwingen, sozusagen im Raum herumwabern. Man könnte auch „schwabern“ sagen. Das Erfinden neuer Wörter oder das Verwenden von altertümlich anmutenden Begriffen trägt übrigens vortrefflich zur Verzauberung bei. Man entwirft und gestaltet so nebenbei gemeinsam eine eigene, besondere Welt. Dies schafft Zugehörigkeit und Bindungsgefühl. Vielleicht gibt es ja in Ihrer Familie auch Begriffe, die sonst niemand kennt? Bei denen andere nur verwundert und ratlos den Kopf schütteln, die für Sie und Ihre Lieben aber selbstverständlich sind? Häufig überleben Wörter, die Kleinkinder geprägt haben, als das Aussprechen von schwierigen Begriffen noch nicht so leichtfiel, ganze Jahrzehnte und gewinnen einen festen Platz im Familienwortschatz. Bei uns ist das der „Mammele“, der heute noch im Badezimmer hängt. (Ich vermute, Sie haben eine ganz gute Vorstellung davon, was das sein könnte.) Sollte Ihnen, liebe Leserin, gerade so ein Begriff in den Sinn kommen, könnten Sie die Augen schließen und voll Neugier schauen, welche Bilder und Erinnerungen Ihr Unbewusstes Ihnen schickt und welche Gefühle und Körperempfindungen damit verbunden sein könnten.
Diese eigene, besondere Welt unterscheidet sich zwar häufig ganz grundsätzlich von unserer Alltagswelt, weist aber doch auch ebenso...









