
Der Musikversteher - Was wir fühlen, wenn wir hören
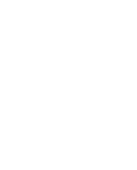
von: Hartmut Fladt
Aufbau Verlag, 2012
ISBN: 9783841205049
Sprache: Deutsch
329 Seiten, Download: 5216 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Einleitung: Eine Sprache, die jeder versteht?
Über babylonische Sprachverwirrungen in der Musik
In vielen Sonntagsreden von Politikern, Gesangsvereinsvorsitzenden, Kulturmanagern und Medienbossen wird ein Satz über die Musik bemüht, der allgemeine Zustimmung genießt. Dabei ist aber der fromme Wunsch der Vater des Gedankens und die Ignoranz seine Mutter. Der Satz lautet: Musik ist eine Sprache, die jeder versteht.
Das ist blühender Unsinn. »Musik« hat dutzende, ja hunderte »Sprachen« mit Tausenden Redewendungen, Vokabeln, mit unterschiedlichster Syntax und Grammatik. Da herrscht eine Sprachverwirrung babylonischen Ausmaßes. Der Satz müsste korrekt lauten: Wer versteht wessen Musik-Sprache NICHT, und warum?
Oft überwältigt uns das Gefühl, kopfüber in die Musik eingesogen zu werden, und dieses »Kopfüber« überwältigt dermaßen, dass es uns wie »kopflos« erscheint: als Gefühl, bei dem Denken und Wissen ausgeschaltet sind, als pure Emotion. Ein solcher metaphorischer »Hörsturz« kann bei jeder Musik geschehen, aus jedem musikalischen Genre, aus jeder historischen Epoche, aus jeder Musikkultur. Nur: was meinen Nachbarn überwältigt, kann mich völlig kaltlassen. Ich flippe da aus, wo meine Kollegin nur den Kopf schüttelt. Und wo Massensuggestionen im Spiel sind, meldet die Vernunft ihr verzweifeltes NEIN an. Warum? Wie kann ein solches Bündel an Widersprüchlichem erklärt werden?
Der Hiphop-Hörer schaltet beim späten Beethoven ebenso ab wie der Beethoven-Fan beim Mainstream-Pop, der Alte-Musik-Spezialist schaltet bei Techno ebenso ab wie der Techno-Freak bei Arnold Schönberg. Wenn sie aber alle zusammen beispielsweise die originalen Haifischgesänge von ozeanischen Fischern hören sollen – oder auch die original Fischer-Chöre aus dem Schwaben-Ländle –, sind sie sich plötzlich völlig einig in kopfschüttelnder Ablehnung. Wie sind diese Ablehnungen begründet?
Einerseits kann man das jeweils andere nicht verstehen – weil wesentliche Voraussetzungen und Kenntnisse fehlen (wohlgemerkt, sie fehlen allen, dem Beethoven-Fan ebenso wie dem Techno-Freak und dem Fischer-Choristen). Andererseits will man das oft auch gar nicht verstehen, und das aus vielfältigen Gründen, die in der Regel sozialpsychologische und private und nicht musikalische Wurzeln haben.
Die politisch korrekte Form der ästhetischen Ablehnung ist übrigens ein durch die Zähne gepresstes »in – ter – es – sant!«
Joseph Haydn war in den 1780er/1790er Jahren der berühmteste Komponist Europas. Als er seinem viel jüngeren Freund Wolfgang Amadé Mozart erzählte, er wolle nach London reisen, um auch dort mit seiner Kunst Erfolg zu haben (das geschah dann auf eine wahrhaft überwältigende Weise), warnte ihn der welterfahrene Mozart, der selbst fünf Sprachen beherrschte: »Sie haben keine Erziehung für die große Welt gehabt, und reden zu wenige Sprachen.« – »O«, erwiderte Haydn, »meine Sprache versteht man durch die ganze Welt.«1
Wenn Haydn hier von der »ganzen Welt« sprach, dann meinte er selbstverständlich die europäische Kulturträgerschicht – die hatte damals eine wirklich weitgehend gemeinsame musikalische »Sprache«. Diese Sprache war das Resultat einer vergleichbaren musikalischen Sozialisation des Publikums, auf der Basis von ähnlichen Bildungsvoraussetzungen. Und dieses Publikum war ebenso selbstverständlich durch soziale Schranken und durch das Bildungsprivileg definiert. Haydns »Londoner Sinfonien« mit ihrer verblüffenden Mischung aus Popularem und höchster Kunstfertigkeit waren nicht für »die« Londoner da, sondern für das gebildete adlig-bürgerliche Publikum, das die Voraussetzungen hatte, diese Musik zu verstehen – und das sich die extrem hohen Eintrittspreise leisten konnte.
Die Utopie der »Idee einer Sprache der Musik« – ohne soziale, ethnische und andere Schranken von allen Menschen verstehbar und erlebbar –, diese zutiefst demokratische Utopie beflügelt die Musik seit der Aufklärung und seit der Wiener Klassik.
Zu dieser wunderbaren Idee gehört es also, dass immer auch das »Populare« in der Musik verankert ist, als ein wesentliches und gleichberechtigtes Element unter anderen. »Pop« kommt ja vom lateinischen »popularis«. »Popular« – das kann man nun englisch oder deutsch aussprechen; wenn man es allerdings englisch oder deutsch denkt, wird man auf Unterschiede stoßen: »Volk« ist im Deutschen durchaus belastet, und wer »popular« als »völkisch« missversteht, hat entweder im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst oder betreibt ein böses Spiel. Dass es in diesem Buch eine gewisse Dominanz von Stücken der Beatles gibt, ist sicherlich auch darin begründet, dass da auf eine im »Pop« des 20. Jahrhunderts singuläre Weise das Populare (oft volksliedhaft eingängig!) mit dem Artifiziellen verknüpft ist.
Auch in der Familie Mozart machte man sich Gedanken über »Pop«: »(…) – vergiß also das sogenannte populare nicht, das auch die langen Ohren Kitzel.« So schrieb Vater Leopold aus Salzburg an den in München weilenden Sohn, und der antwortete: »(…) wegen dem sogenannten Popolare sorgen Sie nichts, denn, in meiner Oper ist Musick für aller Gattung leute; – ausgenommen für lange ohren nicht.«2 Soll heißen: Leopold fordert, dass populare Musik alle Ohren kitzeln solle, auch die der musikalischen Esel. Sohn Wolfgang Amadé stimmt zu: Seine Musik wendet sich an alle Menschen – aber nicht an diese Langohren, die für ihn der Inbegriff störrischer Ignoranten sind. Und das hat nichts mit sozialer Herkunft oder Geschlecht zu tun.
Welche Sprachen der Musik gibt es, sind sie sozial/kulturell definiert, ethnisch, politisch? Was haben sie miteinander zu tun, müssen sie »übersetzt« werden, um verstanden zu werden? Dieses Buch soll insgesamt dazu beitragen, über Grenzen nachzudenken und die verbreiteten Sprachlosigkeiten zu überwinden. Im Mittelpunkt speziell des Kapitels über »Musikalische Grenzüberschreitungen« werden die Tatsachen solcher Grenzen stehen, und ebenso das Nachdenken über ihren Sinn und Unsinn. Dort sind auch Tendenzen zur »Einheitssprache« einer globalisierten Musikindustrie benannt, die bemüht ist, die wunderbare Vielfalt der musikalischen »Sprachen« dem Moloch der ökonomischen Verwertungsprinzipien zu unterwerfen und sie ihm damit zu opfern.
»Man muss die Leute auch mit Schwierigem konfrontieren. Das ist wie der erste Schluck Campari oder Kaffee – zuerst bitter, aber dann beginnt man, es zu lieben.«3 »Musik sollte genossen werden. Unleugbar bietet Verstehen dem Menschen eine seiner genussreichsten Freuden.«4
Das erste Zitat stammt von Gordon Matthew Sumner, besser bekannt als Sting. Und von den genussreichsten Freuden sprach nicht etwa Bertolt Brecht, sondern (ausgerechnet) Arnold Schönberg, der mit seiner oft schroff-sperrigen, dissonanten Musik mit unerbittlichem Wahrhaftigkeitsanspruch nicht unbedingt zum easy listening einlud. Aber auch bei seinen Kompositionen bietet uns das Verstehen die Chance für eine genussreiche Freude.
»Es ist mit dem Witz wie mit der Musik, je mehr man hört, desto feinere Verhältnisse verlangt man.«5
So lautet einer der wunderbaren Aphorismen von Georg Christoph Lichtenberg aus dem 18. Jahrhundert. Befreien wir uns von der Illusion, dass Musik – das gilt auch für die Popmusik – voraussetzungslos und unmittelbar »verstehbar« sei. Selbstverständliche, eingeschliffene Kommunikationsstrukturen verführen immer wieder zu dieser Illusion. »Das kann ich doch mitsingen!« – ja, wunderbar, wenn diese Fähigkeit da ist. Aber wie und warum sie existiert, und warum in den meisten anderen Fällen nicht, das bleibt offen.
Dieses Buch kann nicht den Anspruch haben, ein musiktheoretisches oder musikwissenschaftliches Lehrwerk oder gar eine Kompositionslehre zu sein. Aber: alles, was hier musiktheoretisch und musikwissenschaftlich entfaltet wird, soll die Standards der neuesten Erkenntnisse dieser Disziplinen repräsentieren – in einer verständlichen Sprache, mit den korrekten Begriffen, aber ohne überflüssigen fachterminologischen Ballast. Und diese grundlegenden Einblicke in musikalische Phänomene können sicherlich auch die eigene Kreativität anregen.
In den Grundlagen-Kapiteln des ersten Teils dieses Buches erläutern die zahlreichen Kurzanalysen die entsprechenden übergeordneten musikalischen Sachverhalte. Im zweiten Teil stehen die analytischen bzw. interpretatorischen Ausführungen mehr für sich. Jede dieser Analysen kann separat gelesen werden; gleichzeitig sind sie aber auch zu Gruppen um ein zentrales Thema herum zusammengefasst. Dazwischen sind die von den Gebrüdern Grimm inspirierten Märchen als Parabeln zu lesen, als ein gespiegeltes Panorama des gegenwärtigen Musiklebens. Sie sollen das jeweilige zentrale Thema satirisch erhellen, zur Kenntlichkeit verzerren und gleichzeitig die Kontexte für die Analysen liefern.
Wer fühlen will, muss hören. Genießen wir verstehend. Aber vergessen wir nicht, dass zum Genießen auch das genussvolle Nichtmögen gehört; das erstreckt sich von der rational gesteuerten Ablehnung bis hin zum rational-irrationalen Hassen. Wunderbar, wenn man, beim Anhören etwa von Heino, körpermetaphorisch sagen kann: »Da krieg’ ich kleine Pickel und Pustelchen auf der Haut« (Näheres dazu im Kapitel »Kopf und Bauch«). Noch schöner aber, wenn dieses eher spontane Urteil auch begründbar wird: Die eigene Erfahrung – und die jahrzehntelange Erfahrung im Unterricht, bei Vorträgen, in den Medien, bei Diskussionen, in der Familie –...









