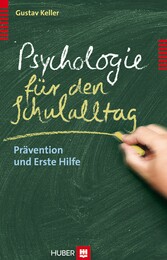
Psychologie für den Schulalltag - Prävention und Erste Hilfe

von: Gustav Keller
Hogrefe AG, 2011
ISBN: 9783456949826
Sprache: Deutsch
155 Seiten, Download: 2286 KB
Format: EPUB, PDF, auch als Online-Lesen
Weil eine Amoktat nie ganz verhindert werden kann, muss sich eine Schule auf den schlimmsten Fall einstellen. Um in einer solchen Extremsituation handlungsfähig zu sein, bedarf es eines Notfallplans und eines gut funktionierenden Krisenteams. Alle Akteure müssen wissen, was zu tun ist und wie schnellstmöglich Hilfe angefordert werden kann. Soweit die Gefahrenlage es erlaubt, gehört zum Krisenmanagement auch die Unterstützung der Polizei und der Rettungskräfte. Sobald der Polizeiund Rettungseinsatz beendet ist, beginnt die Organisation der ersten seelischen Hilfe. Hierfür stehen sowohl Notfallseelsorger als auch Schulpsychologen zur Verfügung. Hauptaufgabe der Schulpsychologen ist es vor allem, mit den betroffenen Schulklassen sowie einzelnen Schülerinnen und Schülern Nachsorgegespräche zu führen und auch abzuklären, wer einer zusätzlichen psychotraumatologischen Behandlung bedarf.
Bei schwerstgradigen Amokläufen wie denen in Erfurt und Winnenden dauert es Jahre, bis die individuelle und kollektive Seelenlage wieder in eine relative Balance zurückgekehrt ist.
Tipps zur schulischen Amokprävention
?? Gehen Sie davon aus, dass in den meisten Fällen ein Amoklauf keine spontane Tat ist, sondern das Ergebnis einer längeren Handlungskette, die präventiv gestoppt werden kann.
?? Beobachten Sie aufmerksam das Verhalten Ihrer Schülerinnen und Schüler. Tauschen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen Ihre Wahrnehmungen aus.
?? Bewerten Sie es als ernst, wenn Schülerinnen und Schüler in Aufsätzen und Zeichnungen Gewaltfantasien äußern oder Gewalttaten und Gewalttäter verherrlichen.
?? Achten Sie auf Schülerinnen und Schüler, die sich zurückziehen, in sich gekehrt sind und in psychischen Sackgassen stecken. Sprechen Sie diese an und erkundigen Sie sich einfühlsam nach Ihrem Befinden.
?? Wird im Gespräch eine seelische Notlage deutlich, bieten Sie dem Schüler an, ihn bei der Suche nach Beratung und Therapie zu unterstützen. Beziehen Sie in die Hilfsaktion seine Eltern ein.
?? Kümmern Sie sich um Schülerinnen und Schüler, die momentan offensichtlich gemobbt werden. Ziehen Sie den Mobbern klare und unmissverständliche Grenzen. Lassen Sie sich dabei von der Schulleitung unterstützen. ?? Veranlassen Sie ein Konfliktgespräch, zu dem der Mobber zusammen mit seinen Eltern eingeladen wird. Schließen Sie einen Anti-Mobbing-Kontrakt mit der Unterschrift der Beteiligten, dessen Einhaltung konsequent kontrol liert wird.
?? Machen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern klar, dass jede Mitteilung, die zur Verhinderung einer schweren Gewalttat führt, unbedingte Pflicht und auf keinen Fall eine «Petze» ist.
?? Sorgen Sie dafür, dass Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Verset zungsordnung oder wegen Normverletzungen die Schule verlassen müssen, eine Alternative finden. Es besteht ansonsten die Gefahr, dass ein nicht mehr kontrollierbares Rachepotenzial entsteht.
Angstprobleme
Man schafft die Angst nicht ab. Denn die Angst ist existenziell und kann nicht verhindert werden.
Paul Tillich
Angst ist ein emotional unangenehmer Zustand. Wenn jemand Angst hat, äußert sich diese aber nicht nur emotional, sondern auch kognitiv (Angstvorstellungen), körperlich (Zittern, Schwitzen, Übelkeit) und verhaltensmäßig (zum Beispiel Vermeidung Angst auslösender Situationen). Angst kann zum einen Ausdruck eines überdauernden Persönlichkeitsmerkmals sein, das man als Ängstlichkeit bezeichnet (Woolfolk, 2008). Zum anderen gibt es auch die Angst als eine kurzzeitige, vorübergehende Reaktion in einer Gefahrensituation.
Nach Auffassung der klassischen Lerntheorie sind viele Angstreaktionen erlernt, und zwar durch Konditionierungsvorgänge. Wird ein Kind in der ersten Schulwoche von einem Mitschüler geschlagen (unkonditionierter Reiz), kann es sein, dass bisher neutrale Reize (Schulklasse, Lehrer, Schulgebäude) mit dem ursprünglichen Ereignis assoziiert werden und ebenfalls Angstreaktionen auslösen, sodass schließlich eine allgemeine Schulangst entsteht. Wenn die familiäre Umwelt die Meidung des Angstobjekts «Schule» unterstützt, indem sie beispielsweise laufend Entschuldigungen schreibt (operante Konditionierung), ist das Reiz-Reaktions-Muster perfekt.
Für die kognitive Lerntheorie spielen im Prozess des Angst-Lernens auch Wahrnehmungen, Bewertungen und Einstellungen eine bedeutsame Rolle. So kann die erworbene Einstellung, dass Prüfungen immer schlimm sind, dazu führen, dass vor und während der Klassenarbeit Angst entsteht. Häufig ist es so, dass solche Angst erzeugenden Kognitionen durch Modell-Lernen oder Indoktrination von familiären oder sonstigen Bezugspersonen übernommen werden.
Wenn jemand Angst empfindet, heißt dies noch nicht, dass ein Angstproblem im klinisch-psychologischen Sinne vorliegt. Angst kann von lebenserhaltender Bedeutung sein, indem sie uns vor Gefahren schützt. Und sie wirkt auch, bei mittlerem Ausmaß, im Leistungsbereich aktivierend (Rost/Schermer, 2010). Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Schüler, der wochenlang nichts mehr für ein Fach gelernt hat, sich angesichts der bevorstehenden Klassenarbeit motiviert fühlt, endlich mit der Vorbereitung zu beginnen. Leistungsmindernd wird die Angst erst dann, wenn ihre Intensität stark zunimmt oder wenn sie von Lehrpersonen und Eltern gezielt als Erziehungsmittel eingesetzt wird. Systematisches Angstmachen schadet vor allem jenen Schülerinnen und Schülern, die ängstlich sind. Sie haben ein negatives Selbstbild von der eigenen Leistungsfähigkeit und zeigen in Leistungssituationen Stressreaktionen. Dadurch bleiben sie in vielen Schulfächern unter dem Niveau, das sie aufgrund ihrer Begabung eigentlich erreichen müssten.
Bei einem Teil der ängstlichen Schülerinnen und Schüler kann sich eine Angststörung im klinischen Sinn entwickeln. Etwa 10 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind davon betroffen (Mattejat et al., 2008). Dabei ist zu beachten, dass Mädchen für Angststörungen anfälliger sind als Jungen. Wenn sich bei einem Schüler eine hochgradige Angststörung mit starker Schulangst und übermäßiger Leistungsbeeinträchtigung zeigt, kann das Problem nur durch eine psychotherapeutische Behandlung gelöst werden. Erste Anlaufstelle ist der Schulpsychologische Dienst, der prüft, ob er mit eigenen Ressourcen helfen kann oder eine Weiterverweisung an eine externe Fachperson oder klinische Institution vornehmen muss.
Vielen Angstentwicklungen kann die Schule durch Prävention entgegenwirken, indem
?? sie gezieltes Angstmachen unterlässt
?? Schülerinnen und Schüler in Misserfolgssituationen ermutigt
?? für Erfolgsgelegenheiten sorgt
?? Lernstoff verständlich darbietet
?? Strategien der Angstbewältigung und Prüfungsvorbereitung vermittelt









