
Stottern - Erkenntnisse, Theorien, Behandlungsmethoden
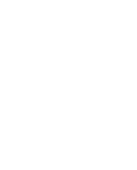
von: Ulrich Natke, Anke Alpermann
Hogrefe AG, 2010
ISBN: 9783456948911
Sprache: Deutsch
169 Seiten, Download: 1160 KB
Format: PDF, auch als Online-Lesen
In den genannten Studien wurden zum Teil auch Kinder einbezogen, die wegen ihres Stotterns therapiert wurden. Aus diesem Grund sind keine genauen Angaben für die spontane Remission, also die Remission ohne formale Therapie, bekannt. Ingham und Cordes (1999a) berichten Ergebnisse von drei Studien mit insgesamt 49 Kindern, die nicht behandelt wurden, und kommen auf eine Spontanremissionsrate von 42,8 %. Aufgrund der geringen Anzahl an Kindern und der Diskrepanz, die auch zwischen den drei ausgewerteten Studien besteht, muss diese Angabe jedoch vorsichtig bewertet werden. Starkweather (1997b) schätzt, dass die Hälfte der behandelten Kinder das Stottern auch ohne Behandlung verliert. In jedem Fall remittiert eine große Anzahl ohne therapeutische Behandlung. Verlässliche Prädiktoren dafür, welche Kinder spontan remittieren, liegen nicht vor (vgl. 7.3 Prognose).
4.5 Verbreitung
Die Verbreitung des Stotterns müsste für eine repräsentative Gruppe der Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt ermittelt werden (Punktprävalenz). Tatsächlich existieren Erhebungen zur Prävalenz des Stotterns bislang nur von Schulkindern. Bloodstein & Bernstein Ratner (2008) listen 18 Studien von U.S.-amerikanischen Schulkindern gegen 28 Studien von europäischen Schulkindern auf und kommen auf eine durchschnittliche Prävalenz von 1,02 % gegen 1,38 %. Während Bloodstein und Bernstein Ratner (2008) hierfür methodische Unterschiede verantwortlich machen, führen Andrews et al. (1983) die Differenz darauf zurück, dass mehr U.S.amerikanische Schulkinder auch nach der Pubertät die Schule besuchten, gleichzeitig jedoch die Prävalenz nach der Pubertät abnehme. Zu beachten ist hierbei außerdem, dass Studien zur Prävalenz schwer zu vergleichen sind, da teilweise unterschiedliche Kriterien zur Bewertung des Stotterns verwendet werden. Allgemein wird von einer Prävalenz bei präpubertären Schulkindern von etwa 1 % ausgegangen. Aufgrund der hohen Spontanremissionsrate kann bei Vorschulkindern von einer höheren Prävalenz ausgegangen werden, obwohl hierzu nur sehr wenige Studien vorliegen. In einer großangelegten Studie von Proctor, Yairi, Duff und Zhang (2008) wurden 3164 Vorschulkinder zwischen 2 und 5 Jahren untersucht und eine Prävalenzrate von 2,52 % festgestellt. Obwohl keine Studien zur Prävalenz bei Erwachsenen vorliegen, so dass diese als unbekannt gelten muss, wird hier häufig ebenfalls 1 % angesetzt, da eine vollständige Heilung im Erwachsenenalter selten auftritt (vgl. 10.8 Effektivität).
Stottern ist unter Epileptikern stärker verbreitet als in der Gesamtbevölkerung, ebenso bei Zerebralparese und anderen neurologischen Syndromen. Conture (2001) schätzt, dass 10 bis 20 % der stotternden Kinder ein Aufmerksamkeits-DefizitSyndrom (ADS) aufweisen, womit die Verbreitung größer als bei der Gesamtpopulation wäre. Healey und Reid (2003) geben Hinweise auf die Behandlung stotternder Kinder mit ADS. Bei geistig Behinderten soll die Prävalenz des Stotterns ebenfalls höher sein, wobei die Angaben von 1 % (keine höhere Prävalenz) bis 45 % schwanken (Boberg, 1977, 1978; Böhme, 1977; Van Riper, 1982; Van Borsel & Tetnowski, 2007). Van Borsel, Moeyaert, Mostaert, Rosseel, van Loo und van Renterghem (2006) fanden mit 2,28 % eine höhere Prävalenzrate bei Schülern an Sonderschulen als bei Schülern an Regelschulen (0,58 %). Fehldiagnosen können allerdings nicht ausgeschlossen werden, da auch berichtet wird, dass typische Verhaltensweisen für Stottern wie z. B. Wortängste und Vermeidungsverhalten fehlen (Boberg, 1977). Van Borsel und Tetnowski (2007) bezweifeln, dass Unflüssigkeiten, die häufig mit genetischen Syndromen wie Prader-Willi-Syndrom oder Tourette-Syndrom einher gehen, als Stottern bezeichnet werden können, da sich diese deutlich vom Muster idiopathischen Stotterns unterscheiden. Gehörlosigkeit ist das einzige Merkmal, bei dem Stottern weniger häufig, sogar extrem selten auftritt (Van Riper, 1982; Andrews et al., 1983).
Van Riper (1982) berichtet, dass klinische Eindrücke sowie einige wenige Studien dafür sprächen, dass die Prävalenz des Stotterns in den USA seit den vierziger Jahren abgenommen habe. Möglicherweise sei dies auf eine toleranter werdende Gesellschaft und Erziehung zurückzuführen.
4.6 Familiäre Häufung, Zwillingsstudien und Vererbung
Stottern tritt familiär gehäuft auf (West, Nelson & Berry, 1939; Gray, 1940; Andrews & Harris, 1964; Ambrose, Yairi & Cox, 1993). In der Untersuchung von West, Nelson und Berry (1939) gaben 51 % der stotternden Personen an, stotternde Verwandte zu haben, während der Anteil bei den nichtstotternden 18 % betrug. Andrews et al. (1983) schätzen, dass bei stotternden Männern 9 % der Töchter und 22 % der Söhne stottern, bei stotternden Frauen 17 % der Töchter und 36 % der Söhne. Es scheint demnach, dass in Familien, in denen mindestens ein Elternteil stottert, Stottern häufiger an die Söhne als an die Töchter übertragen wird. Zwillingsstudien haben eine höhere Konkordanzrate, d.h. eine häufigere Übereinstimmung bei eineiigen als bei zweieiigen Zwillingen, bezüglich des Stotterns ergeben (Seemann, 1937; Nelson, Hunter & Walter, 1945; Howie, 1981; Andrews, Morris-Yates, Howie & Martin, 1991; Dworzynski, Remington, Rijsdijk, Howell & Plomin, 2007). Die familiäre Häufung, der größere Anteil an stotternden Verwandten bei Frauen und die Zwillingsstudien deuten auf die Beteiligung eines genetischen Faktors beim Stottern hin. Die Existenz diskordanter eineiiger Zwillinge spricht nicht gegen einen genetischen Faktor, wenn davon ausgegangen wird, dass lediglich eine Prädisposition für Stottern vererbt wird. Es scheint also ein genetischer Faktor mit Umgebungsvariablen zu interagieren (Cox, Seider & Kidd, 1984; Kidd, 1977, 1980, 1985). Ein spezifisches Vererbungsmodell ist noch nicht ermittelt worden (Kidd, 1985), denkbar wären eine monogenetische oder eine polygenetische Vererbung (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008). Auch Versuche, ein oder mehrere Gene zu lokalisieren, die Stottern verursachen, führten bislang zu uneinheitlichen Ergebnissen (Viswanath, Lee & Chakraborty, 2004; Shugart, Mundorff, Kilshaw, Doheny, Doan, & Wanyee, 2004; Riaz, Steinberg, Ahmad, Pluzhnikov, Riazuddin & Cox, 2005; Suresh, Ambrose, Roe, Pluzhnikov, Wittke-Thompson, Ng et al., 2006; Wittke-Thompson, Ambrose, Yairi, Roe, Cook, Ober & Cox, 2007). Eine geschlechtsspezifische Untersuchung von Suresh et al. (2006) deutet darauf hin, dass Stottern bei Männern mit Chromosom 7 assoziiert ist, während bei Frauen Chromoson 21 eine Rolle spielt.
Ambrose, Cox und Yairi (1997) schließen aus Daten, die an 66 stotternden Kindern erhoben wurden, dass die Tatsache, ob Stottern persistiert oder das Kind remittiert, genetisch übertragen werde, diese beiden »Formen« des Stotterns jedoch keine genetisch unterscheidbaren Störungen darstellten. Dworzynski et al. 2007) kommen in ihrer longitudinalen Studie mit 12892 Kindern zu einem ähnlichen Ergebnis und betonen ebenfalls den genetischen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer Remission. Dennoch gehen die Autoren von einer Interaktion genetischer und umweltbezogener Faktoren aus und verweisen darauf, dass der Anteil des Einflusses beider Faktoren auf die Remission bislang noch nicht geklärt ist. Die Schwere des Stotterns scheint nicht vererbt zu werden (Kidd et al., 1980). Adoptionsstudien, die im Zusammenhang mit einem genetischen Faktor beim Stottern bedeutsam wären, liegen bislang nicht vor.
Andrews et al. (1991) schätzen anhand einer Studie mit 3810 zufällig ausgewählten Zwillingspaaren, dass genetische Faktoren 71 % und Umgebungsfaktoren 29 % der Wahrscheinlichkeit ausmachten, ob jemand zu stottern beginne. Kidd (1980) kommt zu dem Ergebnis, dass 86 % der Varianz genetisch und 14 % umgebungsbedingt sei. Unter Umgebungsvariablen fallen in diesem Zusammenhang alle nichtgenetischen Einflussfaktoren, also beispielsweise auch solche, die bereits auf den Fötus einwirken.
Genetische Faktoren spielen offenbar bei der Entstehung des Stotterns eine Rolle. Es ist plausibel, eine Prädisposition für Stottern anzunehmen, wobei die Art dieser Prädisposition unbekannt ist. Neurophysiologische Unterschiede zwischen stotternden und nichtstotternden Personen, die direkt zum Stottern führen, wurden bislang nicht gefunden (vgl. 8 Unterschiede zwischen stotternden und nichtstotternden Personen). Guitar (2006) merkt an, dass sich eine Prädisposition beispielsweise auch darauf beziehen könne, wie empfänglich eine Person für klassische Konditionierung sei.







